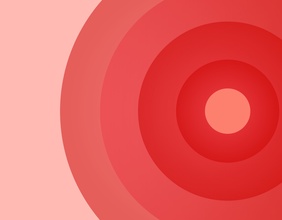Israels Gründungsmythos auf dem Prüfstand
Die Erfindung des jüdischen Volkes
"Die Erfindung des jüdischen Volkes" von Shlomo Sand ist ein Bestseller. Einer, der höchst widersprüchliche internationale Reaktionen auslöst: Ein jüdisches Volk, so der Autor, gäbe es nicht, es alles nur eine Erfindung europäischer Zionisten im 19. Jahrhundert.
8. April 2017, 21:58
Die Tragödie anerkennen
"Ich bin nicht gegen die Existenz Israels", sagt der israelische Historiker Shlomo Sand, "das wäre nicht nur dumm, sondern auch gefährlich. Es wäre Unsinn, gegen die Existenz des Staates Israels zu opponieren - aber wenn Sie mich zum Jahr 1947 befragen - die Gründung Israels stellt ein moralisches Problem dar. Es war offenkundig eine Tragödie für die lokale Bevölkerung. Wir können die Geschichte nicht rückgängig machen - aber Israel muss anerkennen, was auf Arabisch und heute auch auf Hebräisch als 'Nagba' bezeichnet wird - die Tragödie für die Palästinenser. Sie haben uns nichts getan, aber die Errichtung unseres Staates schuf ein Flüchtlingsproblem, das bis heute nicht gelöst ist - das aber gelöst werden muss."
Shlomo Sand hat mit "Die Erfindung des jüdischen Volkes" nicht nur einen Bestseller geschrieben, der in Israel wochen- und monatelang auf den Verkaufslisten ganz oben stand; das Buch, das zahlreiche, höchst widersprüchliche internationale Reaktionen auslöste, hat auch ein Problem: Es wurde nicht als Bestseller verfasst. "Die Erfindung des jüdischen Volkes" - stilistisch ziemlich flüssig und gekonnt geschrieben - ist inhaltlich eine ziemlich sperrige Abhandlung zu einem höchst akademischen Thema: Wie schreibt man Geschichte, neudeutsch - wie "konstruiert" man Geschichte, und was folgt daraus?
Produkt des 19. Jahrhunderts
Im Fall des Judentums und des Staates Israel handelt es sich um eine höchst verzwickte Geschichte. Shlomo Sands These: Das - heute über die ganze Welt verstreute - Volk der Juden wurde wie "die Franzosen", oder wie "die Deutschen" im 19. Jahrhundert erfunden, als Ausdruck jenes Nationalismus, der einmal auch als "Geisteskrankheit" mit allen daraus resultierenden negativen Folgen bezeichnet wurde. Es gebe weder das von Jahwe "auserwählte Volk", noch habe dessen Vertreibung stattgefunden. Das daraus resultierende Recht auf Rückkehr in die historischen Heimat und der Alleinanspruch auf das Gelobte Land würden dadurch aber hinfällig. Wenn überhaupt, so seien eher die Palästinenser als die aus Europa eingewanderten Juden ethnische Nachkommen der biblischen Israeliten.
Jüdische Geschichtsschreibung
Shlomo Sand versucht die Angelegenheit in mehreren Anläufen zu beweisen, respektive zu widerlegen. In einem ersten Schritt werden Begriffen wie "Nation", "Ethnos", und "Rasse", wie sie das 19. Jahrhundert hervorbrachte, diskutiert und definiert. Dann folgt ein umfangreicher und umsichtiger Lauf durch die Geschichte jüdischer Geschichtsschreibung: von Flavius Josephus, der seine Geschichte der Juden selbstredend mit der Schöpfung der Welt beginnen lässt, und mit Gott, der Moses die Thora diktiert. Die Suche nach genealogischen Ursprüngen schloss für den hellenistischen Historiker auch Adam und Eva, die Sintflut und die Taten Noahs mit ein.
Eine allgemeine Jüdische Geschichte wurde, so Sand, erst wieder in der Neuzeit in Angriff genommen: Ihren Höhepunkt erreicht diese mit Heinrich Graetz, mit Moses Hess und später mit Simon Dubnow im 19. und 20. Jahrhundert.
Zeitumstände einbeziehen
Shlomo Sand kontextualisiert die Arbeit der jüdischen Geschichtsschreiber mit den jeweiligen Zeitumständen: mit der Geschichte der Pogrome, den Debatten über Rasse und Geschichte, über Biologie, Theologie und Archäologie, über Assimilation und Zionismus. Und natürlich behandelt der Historiker auch sämtliche Spielarten des Zionismus, beginnend bei Theodor Herzl, dessen 150. Geburtstag kürzlich gefeiert wurde.
"Sie fragen, ob ich dem Zionismus gegenüber kritisch war: Ja - das war ich! Aber wir teilten trotzdem die allgemeinen Vorstellungen von unserer Geschichte", sagt Sand. "Obwohl ich links war, war ich überzeugt, dass das jüdische Volk aus Palästina vor 2.000 Jahren vertrieben worden war. Vielleicht dachten wir als Linke nicht gerade daran, dass man nach 2.000 Jahren Abwesenheit irgendwelche Rechte auf das Land - auf das Land Palästina - hatte; und man konnte auch keine Welt wie vor 2.000 Jahren wiedererrichten. Aber trotzdem waren wir überzeugt, dass es das Exil der Juden gab: Im Jahr 70 nach Christus erfolgte die Zerstörung des Tempels - das war sicher, das war unumstößlich."
Von Chasaren zu Ashkenasi
Eine von Shlomo Sands Wiederentdeckungen ist eine Gegenerzählung zum Mythos von Vertreibung und Exil der Juden aus dem biblischen Königreich Judäa. Sand zufolge resultierte die rasche Ausbreitung der Juden im Mittelmeerraum, in Nordafrika, Arabien sowie Süd- und Zentralasien aus massenhafter Konversion.
Im Zentrum von Sands Argumentation stand das Reich der Chasaren - ursprünglich ein Turkvolk, das zum Judentum konvertiert war. In der Wolga-Don-Steppe zwischen Kaspischem und Schwarzem Meer ansässig, standen die Chasaren am Ursprung der sogenannten jiddischen Kultur, und somit der europäischen Juden, der sogenannten Ashkenasi. Die politische Implikation dieser Idee ist klar: In der Unabhängigkeitserklärung des Staates Israel aus 1948 ist von der "Anstrengung, in das Heimatland zurückzukehren und es in Besitz zu nehmen" die Rede; beides beruhe auf "historischer" und "religiöser Verbundenheit".
Exil wichtiger als Shoah?
"Im jüdischen, israelischen Bewusstsein war der Akt des Exils bis vor wenigen Jahren noch wichtiger als die Shoah. Warum? Weil es die Grundlage für das Bild von den Juden in der Welt ist", erklärt Sand. "Die Juden wurden aus Palästina exiliert."
Nicht zuletzt sieht sich auch Shlomo Sand selbst als Nachfahre dieser europäischen, osteuropäischen - jiddischen - Kultur, die über kein exklusives Recht auf Rückkehr verfügt habe. Sand wurde 1946 als Kind polnischer Juden in einem Flüchtlingslager in Linz geboren, seine Eltern waren erst vor Hitler in die UdSSR und dann nach dem Krieg weiter in den Westen geflüchtet. In Europa sei für Juden damals kein Platz gewesen, auch die USA hätten bis 1950 keine jüdischen Flüchtlinge aufgenommen. Nach zwei weiteren Jahren in bayrischen Flüchtlingscamps wanderte die Familie in den neu gegründeten Staat Israel aus.
Das Motto in "Die Erfindung des jüdischen Volkes" lautete demnach auch: "In Erinnerung an alle Flüchtlinge, die dieses Land erreichten, und an all jene, die es verlassen mussten."
Prägende Kriegs-Erfahrung
Die Vertreibung der Araber während des Unabhängigkeitskrieges erlebte Shlomo Sand noch nicht bewusst - umso prägender war für ihn der Sechs-Tage-Krieg des Jahres 1967: Für den jungen israelischen Kommunisten, der zu dieser Zeit in der Armee diente und an den Kämpfen in Jerusalem teilnahm, stellte der Krieg auch den Impuls, selbst Historiker zu werden, dar.
"1967 kam ich aus dem Krieg als junger Mann zurück", erzählt Sand, "nebenbei nicht als Student, sondern als Arbeiter, und ich sah, wie sich die Israelis im Sieg verhielten - es ist nicht nur schrecklich ein Volk in der Niederlage zu sehen, es ist auch schrecklich, den Sieg zu sehen. Sie waren trunken vor Sieg - sie träumten von einem großen Staat Israel bis über den Jordan hinaus. Selbst die Linken träumten davon. In dieser Atmosphäre wurde der junge, nicht besonders kluge 21-jährige Bursche namens Shlomo Sand sehr viel radikaler. Ich schloss mich für zwei Jahre einer antikommunistischen Linksgruppe an, und verließ sie wieder, als die Aufteilungen in Trotzkisten und Maoisten immer dämlicher wurden. Ich war dann ziemlich verzweifelt, und ich entschied mich zu studieren. Wenn ich die Geschichte nicht ändern konnte, so wollte ich sie zumindest studieren."
Service
Shlomo Sand: "Die Erfindung des jüdischen Volkes. Israels Gründungsmythos auf dem Prüfstand", aus dem Hebräischen von Alice Meroz, Propyläen Verlag
Propyläen Verlag
Übersicht
- Judentum