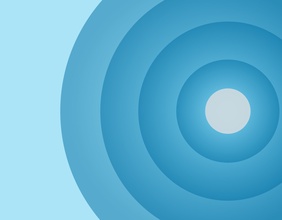Andere Agrar- und Lebensmittelpolitik gefordert
Ernährungssouveränität
Laut Vereinten Nationen wird die Weltbevölkerung bis 2050 auf neun Milliarden Menschen anwachsen. Und schon heute hungert etwa eine Milliarde. Viele der Hungernden sind selbst Kleinbauern in sogenannten Entwicklungsländern. Sie werfen der EU vor, durch subventionierte Billigprodukte die Märkte der armen Länder zu überschwemmen.
8. April 2017, 21:58
Gleichzeitig bedrohen Umweltzerstörung und Klimawandel den Planeten und das Erdöl geht zu Ende. Soll man Anbauflächen also besser für Lebensmittel oder Agrotreibstoffe verwenden? Über all diese Fragen muss sich die Europäische Union Gedanken machen. Schließlich soll bis Ende 2013 eine neue gemeinsame europäische Agrarpolitik beschlossen werden. Diese möge bitte völlig anders aussehen, als die bisherige, fordern die globalisierungskritische Organisation ATTAC und Via Campesina, ein weltweites Netzwerk von Kleinbauern. Sie haben ihre alternativen Visionen einer nachhaltigen Landwirtschaftspolitik in Buchform herausgebracht: "Ernährungssouveränität. Für eine andere Agrar- und Lebensmittelpolitik in Europa" lautet der Titel.
Weniger Fleisch essen
Die gute Nachricht zuerst: Ja, es wäre theoretisch möglich, die Weltbevölkerung auch in 40 Jahren noch zu ernähren. Und das ohne die Umwelt zu zerstören und ohne das Klima weiter anzuheizen, sagen die Autoren und Autorinnen des Buches "Ernährungssouveränität". "Die FAO, die UNO-Welternährungsorganisation sagt: Bereits heute könnten wir mit dem, was wir an Lebensmitteln produzieren, neun Milliarden Menschen ernähren", so Alexandra Strickner, eine der Herausgeberinnen des Buches. "De facto haben wir die Produktionskapazitäten."
Die schlechte Nachricht: Wenn wir so weitermachen wie bisher, dann wird das nicht funktionieren. Es braucht tiefgreifende Veränderungen in der Landwirtschaftspolitik. Und nicht allen würden diese Veränderungen gefallen. Zum Beispiel vielen europäischen Konsumenten nicht. Denn für neun Milliarden wird es sich nur dann ausgehen, wenn wir unsere Ernährungsgewohnheiten ändern. Zu Deutsch: weniger Fleisch essen, erklärt Ökonomin Alexandra Strickner:
"Wir wissen, dass die Herstellung eines Kilo Fleisches zehn Kilogramm Getreide braucht. Das heißt wenn wir weniger Fleisch essen - das heißt nicht, dass wir alle Vegetarier werden müssen, aber wenn wir den Fleischkonsum massiv reduzieren, dann würde das heißen, dass Getreide in viel größeren Maßen zur Verfügung stehen würde und eine größere Weltbevölkerung ernähren kann."
Nachdem die Leute wohl kaum aus moralischen Gründen auf Fleisch verzichten, müsste das über den Preis geregelt werden, sagt Alexandra Strickner. Fleisch würde automatisch teurer werden, wenn die EU aufhöre, Billig-Futtermittel beispielsweise aus Südamerika zu importieren.
Mehr lokale Produkte konsumieren
Apropos weiter Transport: Die derzeitige Landwirtschaft verbraucht enorm viel Erdöl. Einerseits, weil Rohstoffe quer über den Planeten transportiert werden, und andererseits, weil Düngemittel und Pestizide aus Erdöl hergestellt werden. Doch die Erdölvorräte gehen langsam zu Ende. Daher fordert das Konzept der Ernährungssouveränität: mehr lokale Produkte konsumieren. Weg von großer industrieller Landwirtschaft, hin zu kleinbäuerlichen Strukturen:
"Ganz zentral in diesem Konzept ist zum einen eine ökologisch nachhaltige Form der Produktion in der Landwirtschaft", meint Strickner. "Ganz zentral ist auch, dass die Kontrolle über die Ressourcen bei den Produzent/innen liegt, zum Beispiel Saatgut nicht in den Händen von Konzernen sein soll, sondern Bauern und Bäuerinnen das Recht haben sollen, Saatgut zu tauschen und auch selber herzustellen."
Und dieser Lösungsansatz dürfte vor allem den großen Agrarkonzernen missfallen. Monsanto, Syngenta und Pioneer erzeugen landwirtschaftliche Chemikalien und Saatgut. Sie achten streng auf ihr Copyright - vor allem bei genmanipuliertem Saatgut - und verbieten den Bauern, es selbst nachzuzüchten. Das Argument, dass man die Weltbevölkerung ohne industrielle Monokulturen, Hybridsorten und Gentechnologie gar nicht ernähren könnte, hält Alexandra Strickner wörtlich für einen "PR-Gag" der Agro-Industrie:
"Das sagen die, um sicherzustellen, dass Politiken stärker in diese Richtung gemacht werden. Es geht lediglich darum, dass diese Unternehmen die gänzliche Kontrolle über die Landwirtschaft anstreben und ihren Profit noch mehr erhöhen wollen."
Die Macht der Konzerne
Auch die europäischen Handelsketten dürften keine Freude haben mit den Vorschlägen der Buchautoren, denn die fordern faire Preise für die Bauern. Sie sollen vom Verkauf ihrer Produkte leben können und nicht nur von Subventionen. Bauer sollte wieder zu einem lebenswerten und gesellschaftlich anerkannten Beruf in Europa werden. Doch das muss nicht zwangsläufig heißen, dass Lebensmittel unerschwinglich werden für die Konsumenten, sagt Buch-Herausgeberin Alexandra Strickner:
"Insofern haben wir das Problem von ganz stark vermachteten Strukturen, also großen Konzernen, die einerseits in Richtung der Bauern Preise setzen und sagen: Ok, wir zahlen euch halt nur das. Und umgekehrt auch uns gegenüber die Preise setzen. Es gibt zahlreiche Beispiele, wo Bauern und Konsumenten gesagt haben, wir wollen dieses System nicht mehr, und sich zusammentun. Und wo dann Bauern einen fairen Preis für ihre Produkte kriegen und die Konsumenten eigentlich weniger zahlen."
Mehr direkter Vertrieb also: von den Produzenten direkt zu den Konsumenten.
Keine Finanzspekulationen mehr
Weiters fordern die Autoren und Autorinnen des Buches "Ernährungssouveränität" eine Regulierung der Finanzmärkte. Was das mit Agrarpolitik zu tun hat? Lebensmittelspekulanten treiben die Preis künstlich in die Höhe, erklärt Alexandra Strickner:
"Wir sehen jetzt, dass Spekulation in dem Bereich bereits 2007/08 und jetzt wieder einen Beitrag leistet zu dieser Preistreiberei. Das kann man nicht von der Hand weisen. Das wird sehr gerne von der Hand gewiesen von einigen, indem man sagt: Das ist Indien und China, die viel mehr konsumieren und die Agrotreibstoffe. Natürlich spielen diese Faktoren hinein, das ist nicht von der Hand zu weisen. Daher ist es ganz dringend notwendig, dort wo die Märkte existieren, dass man die stark reguliert. Institutionelle Investoren, wie Pensionsfonds und Hedgefonds. Die haben in diesem Markt nichts zu suchen."
Nachwehen der GAP
An der bisherigen gemeinsamen Agrarpolitik der EU kritisieren die Autoren vor allem, dass sie einseitig ausgerichtet ist auf Export, Überproduktion und Dumpingpreise. Das wiederum hängt mit ihrer Geschichte zusammen: Als die gemeinsame europäische Agrarpolitik - kurz: GAP - in den 1950ern ins Leben gerufen wurde, herrschte ein Mangel an Nahrungsmitteln in Europa.
Doch schließlich wurde die GAP Opfer ihres eigenen Erfolges. Mit Hilfe von hohen Agrarsubventionen wurden Butterberge und Milchseen produziert. Viele europäische Billigprodukte landeten auf den Märkten von Entwicklungsländern und trugen zur Zerstörung der Lebensgrundlage der dortigen Bauern bei. In Europa selbst verdrängten Großgrundbesitzer die kleinen Bauern.
Die europäische Agrarpolitik wird heute dominiert von den Interessen der großen exportorientierten Agro-Unternehmen, kritisiert Alexandra Strickner: "Im europäischen Politikprozess funktioniert es so, dass die Kommission zu vielen Themen Expertengruppen einrichtet. Dort wissen wir, dass in fast allen Bereichen in erster Linie Vertreter von Industriegruppen sitzen. Das wird dort nicht viel anders sein. Und die sitzen natürlich mit ihren Lobbyisten auch in Brüssel, haben unglaublich viel Geld, um Studien zu schreiben, um Informationen aufzubereiten und das macht es für andere Gruppen mit anderen Vorstellungen viel schwieriger."
Alexandra Strickner ist - trotz aller entgegenlaufenden Wirtschaftsinteressen - optimistisch, dass eine andere Landwirtschaftspolitik möglich ist. Nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Spätestens dann, wenn das Erdöl wirklich zu Ende geht.
Service
Gérard Choplin, Alexandra Strickner, Aurélie Trouvé (Hg), "Ernährungssouveränität. Für eine andere Agrar- und Lebensmittelpolitik in Europa", Mandelbaum Verlag
Übersicht
- Konsument/innen