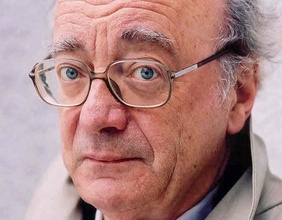Live-Übertragung, Surround Sound und Webradio
01. Technik im Hörspiel
30. März 2017, 17:10
Die Geschichte der Aufnahme- und Archivierungstechnik im österreichischen Hörspiel kann hier nicht im Detail erläutert werden. Sie reicht von den Live-Übertragungen, den Wachsmatritzen und Schellackplatten der Frühzeit, über das Tonband, das erstmals die Schnittmöglichkeit eröffnete, bis zur digitalen Hörspielproduktion. Diese Geschichte reicht auch von der mono-Aufnahme über die Stereo-Technik (seit 1966), von "Kunstkopf"- und Quadrophonie-Produktionen bis hin zu den neuen Dolby-Surround- bzw. DD 5.1-Aufnahmen und Sendungen sowie zur Einbeziehung des Internets in den Hörspielbereich (vor allem durch die Sendereihe "Kunstradio").
Einführung der Digitaltechnik
Bereits im Juni 1988 wurde mit dem damals fertig gestellten Regieplatz 4 im Funkhaus Wien der ORF nach der BBC und dem WDR weltweit die dritte Rundfunkanstalt mit einer großen digitalen Produktionsregieanlage. Die Umwandlung der Mikrofonsignale in den digitalen Datenstrom erfolgte dabei unmittelbar nach den Mikrofonen im Studio. Die digitalen Aufnahmen konnten auf einer digitalen 24-Spur Tonbandmaschine (Sony 3324) und auf 2-Kanal (Stereo-) Aufzeichnungsmaschinen (U-Matic 1630) gespeichert werden. Der digitale Regietisch (ein NEVE Digital Signal Prozessor (DSP)-Regiepult) ermöglichte die frei wählbare Zuordnung beliebiger Funktionen wie Filter, Verzögerungen, Limiter zu Ein- oder Ausgängen, und war mit dem NECAM Automatisierungssystem ausgestattet, mit welchem die Einstellung der Hauptregler fortlaufend und taktgenau abgespeichert und auf Knopfdruck wiederhergestellt werden konnte.
Das erste durchgängig digitale Hörspielstudio im Rundfunk wurde Anfang Januar 1994 mit dem neuen Studio 7 des WDR in Betrieb genommen. Bereits im Jänner 1995 folgte das Wiener ORF-Funkhaus mit dem Wechsel zur volldigitalen Hörspielproduktion auf harddisk-recording-Basis (System Fairlight). Seit 2004 werden die Hörspiele auf zentraler Harddisk archiviert und als digitale Soundfiles gesendet (terrestrisch noch analog, über Satellit digital).
Die Sendereihe "Kunstradio" leistete in der 5.1-Technik Pionierarbeit, man denke nur an den ersten Test der praktischen Durchführbarkeit von Mehrkanal-Radio, wobei die "Lange Nacht der Radiokunst 2004" mit dem Titel "Re-Inventing Radio" komplett in diskreter 5.1-Mehrkanaltechnik realisiert und gesendet wurde (innerhalb des ASTRA ORF-Transponders 117 wurde für den Testzeitraum ein eigener Radiokanal in den Multiplexer konfiguriert).
Historisches
Pars pro toto noch ein Blick in die fernere Historie von Professor Wolf Harranth:
Ich erinnere mich an die Aufzeichnung von "Götz von Berlichingen" (1949). Die wurde damals noch auf Lackplatten gemacht. Die ersten Magnetofon-Aufzeichnungen machten Probleme, weil die Tonbänder von Agfa-Wulfen (DDR) kamen und die Haftung schlecht war. Die 20-Minuten Kuchen (1.000m) waren unhandlich, und immer wieder brachen die Bobinen durch. Dann rollten wir auf dem langen Funkhaus-Gang die Bänder auf, entwirrten sie und haspelten sie von Hand wieder auf die Bobinen. Geklebt wurde mit flüssigem Kleber, der Blasen warf, bei der Wiedergabe einen Blubberer machte - und natürlich gingen die Bänder beim Abspielen an den Klebestellen immer wieder auf.
Aus der unmittelbaren Nachkriegszeit sind von der RAVAG nur einige Bänder der Russischen Stunde erhalten (keine Wortaufnahmen). Der Sender ROT WEISS ROT verfügte über amerikanisches Material und hat von Anfang an viel aufgezeichnet. Leider hat Intendant Hartl 1955 bei der Übergabe die Vernichtung des gesamten RWR-Archivmaterials angeordnet (sodass nur einige Produktionen über Umwege erhalten sind). Die RAVAG verwendete übrigens ab 1933 das von Czeijas Firma Selenophon entwickelte "Tönende Papier" (Lichtton). Toscanini nahm ab 1937 nur noch auf der "U7" auf, und der Lichtton wurde dann auch vom Tonfilm übernommen.