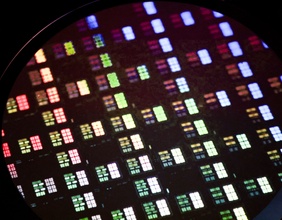Die Stärkung der eigenen Sprache
Afrika, Kontinent der Vielfalt
Rund ein Drittel der weltweit gesprochenen Sprachen wird in Afrika verwendet. Würde man die Sprachendichte des westafrikanischen Kamerun beispielsweise auf die Fläche Österreichs übertragen, gäbe es hier an die 160 Sprachen.
8. April 2017, 21:58
Jede einzelne der - Schätzungen von Sprachwissenschaftlern zufolge - 2.000 afrikanischen Sprachen reflektiert einen bestimmten sozialen, kulturellen, historischen und politischen Hintergrund. Und jede einzelne wurde vom Kolonialismus des 19. und 20. Jahrhunderts unterdrückt und an ihrer Entwicklung behindert.
Schweres Erbe des Kolonialismus
"Die Folgen spürt man heute noch", sagt der Linguist Adama Samassekou. Der ehemalige Bildungsminister der westafrikanischen Republik Mali ist Hauptverantwortlicher der fünf Jahre jungen Afrikanischen Akademie der Sprachen. Das Ziel der Unterorganisation der Afrikanischen Union, in der fast alle 53 afrikanischen Staaten Mitglied sind, ist, die afrikanischen Sprachen aufzuwerten, zu fördern und aus ihnen Arbeitsinstrumente in Schule, Verwaltung und Medien zu machen.
Denn auch heute noch fungieren in den meisten subsaharischen Staaten als Amtssprache das Französische, Englische oder die Sprache einer anderen ehemaligen Kolonialmacht. Ähnlich sei die Situation in vielen Bildungsinstitutionen, sagt Adama Samassekou: "Der Schlüsselbereich, in dem wir unsere eigene Sprache entwickeln müssen, ist die Bildung, gefolgt von den Medien und der Justiz."
Demokratische Partizipation und höhere Bildungsstandards
Derzeit werden alle offiziellen Bekanntmachungen in den Amtssprachen publiziert. Also in den Sprachen der Kolonialmächte. Das bedeutet, dass der Großteil der Bevölkerung nicht an den Entscheidungsprozessen teilnehmen kann: "So lange 75 bis 80 Prozent der Bevölkerung nicht in ihrer Muttersprache lesen und schreiben können, ist es nicht möglich von Demokratie oder einer verantwortungsbewussten Regierungsführung zu sprechen."
Es gelte, ein neues Bildungssystem aufzubauen, dessen Fundament die Sprachen der Region, die Muttersprachen der Bevölkerung bilden. Denn ein Kind lerne am einfachsten und schnellsten in seiner Muttersprache. "Wie solle auch mithilfe einer in der persönlichen Umgebung nicht präsenten und daher völlig fremden Sprache Mathematik erlernt werden?" fragt Samassekou.
Bestrebungen einzelner afrikanischer Staaten hin zum Unterricht in der Muttersprache gibt es seit längerem. Koordinieren will diese nun die Afrikanische Akademie der Sprachen. Ihr geht es nicht darum, die Kolonialsprachen zu ersetzen. Sondern darum, den afrikanischen Bürgern mit einem in der Muttersprache abgehaltenen und damit verständlicheren Unterricht einen insgesamt höheren Bildungsstandard zu ermöglichen.
Jahrelanger Entwicklungs-Prozess
Ende der 1970er und 1980er Jahre unterstützen europäische sowie amerikanische Linguisten und Erziehungswissenschaftler das westafrikanische Nigeria bei der Einführung von neun der zwölf meistgesprochenen Sprachen. So konnte man im bevölkerungsreichsten Land des Kontinents immerhin mehr als zwei Drittel der Menschen erreichen, erinnert sich Norbert Cyffer, Linguist am Institut für Afrikanistik der Universität Wien.
Der Prozess dauerte allerdings Jahre. Es musste eine einheitliche Orthographie gefunden, Schulbücher verfasst und Lehrer neu ausgebildet werden. Sie konnten nicht von einem Tag auf den anderen die Unterrichtssprache wechseln. Cyffer: "Wir hielten an der Universität im Nordosten Nigerias einjährige Lehrer-Kurse ab. Die besten Absolventen des Lehrgangs bekamen die Möglichkeit, ein Graduiertenstudium anzutreten. Das heißt, wir bemühten uns, Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die nigerianischen Kollegen ehest möglich unsere Aufgaben übernehmen können." Heute ist das Land von ausländischen Wissenschaftlern unabhängig.
"Politischen Willen gibt es"
Die Umsetzung des Hauptziels der Afrikanischen Akademie der Sprachen birgt Schwierigkeiten: In peripheren Regionen sind die Lehrer meist schlechter ausgebildet und die Schulen nicht besonders gut mit neuen Unterrichtsmaterialien ausgestattet. Für die meisten städtischen Schulen ist die ethnische Vielfalt charakteristisch. Dann sei es schwierig, allen Schülern Unterricht in der Muttersprache anzubieten. Zudem halten sich Sprachen nicht an die von den Kolonialmächten festgelegten Grenzen.
So kommt es, dass die Rechtschreibung ein und derselben Sprache in einem Land ganz anderen Regeln folgen kann als im anderen. Man stehe noch am Anfang, doch den politischen Willen zur länderübergreifenden Zusammenarbeit gäbe es, sagt Adama Samassekou: "Das derzeitige Ziel ist, die Terminologie der verschiedenen Fachbereiche weiterzuentwickeln und zu harmonisieren, ebenso wie die Rechtschreibung und die Lehrpläne. Standardisierung, Harmonisierung und Normalisierung - das sind die großen Aufgaben der Akademie."
Mehr zur Sprachvielfalt in Südafrika in oe1.ORF.at
Hör-Tipp
Dimensionen-Magazin, Freitag, 20. Oktober 2006, 19:05 Uhr
Download-Tipp
Ö1 Club-DownloadabonnentInnen können die Sendung nach der Ausstrahlung 30 Tage lang im Download-Bereich herunterladen.
Link
Afrikanische Akademie der Sprachen
Institut für Afrikanistik der Universität Wien
Stanford University - Afrika