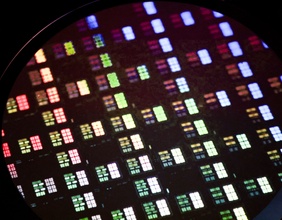Thomas Klings Lyrik
Gesammelte Gedichte
Kling war ein Sprachbesessener. Er liebte das Wortspiel und das Spiel der Visualisierung von Wörtern. Nun haben seine Autorenkollegen Marcel Beyer und Christian Döring seine "Gesammelten Gedichte" aus den Jahren von 1981 bis 2005 herausgegeben.
8. April 2017, 21:58
Er sei ein "Poesie Gratwanderer", ein "Poesie Lunatiker", ein "Magier einer ins nächste Jahrtausend weisenden Sprachverwirklichung." Mit diesen Worten hat die Grande Dame der deutschsprachigen Literatur, Friederike Mayröcker, den Dichter Thomas Kling beschrieben. Kling ist 2005 im Alter von 47 Jahren verstorben.
Nun haben sich seine Autorenkollegen Marcel Beyer und Christian Döring gemeinsam auf den Weg gemacht und im DuMont Verlag Klings "Gesammelte Gedichte" aus den Jahren von 1981 bis 2005 herausgegeben. Was da auf den fast 1000 Seiten Lyrik zum Vorschein kommt, gleicht einem Oeuvre, das sich einem langen Leben verdankt.
Ein Sprachbesessener
Kling als "Poesie Lunatiker" war kein mondsüchtiger Schöngeist, der dann und wann an einem Gedicht feilt, sondern er war ein Sprachbesessener. In seinem lyrischen Werk arbeitet er mit Ellipsen, verfremdeten Zitaten, er liebt das Wortspiel und das Spiel der Visualisierung von Wörtern. Manchmal zersägt er förmlich die Worte, so dass nur noch kleinste Bedeutungselemente übrig bleiben.
Aber Kling ist auch ein echter Natur- und Liebeslyriker, der sogar in seinen Gedicht-Zyklen Geschichten erzählt. Außerdem hat er seine eigene Tradition ganz bewusst zusammengestellt: Sie reicht von Catull über den spätmittelalterlichen Minnesänger Oswald von Wolkenstein bis zu Expressionismus und Dadaismus, bis zu Autoren wie Ernst Jandl und Friederike Mayröcker.
Zyklus "Bildprogramme"
Kling hat seine Jugend in Düsseldorf verbracht und zeitweilig in Köln und Wien gewohnt. Deswegen schätzt er den rheinischen Dialekt-Singsang genau so wie den Wiener Slang mit seinen oft poetischen Wortbildungen. Überhaupt setzt Kling stark auf das gesprochene Wort, also auf die Rezitation der Gedichte.
Das Gedicht "Zwischnbericht" zum Beispiel stammt aus dem Zyklus "Bildprogramme". Es sind Bildbeschreibungen oder Beschreibungen von historischen Räumen. Man befindet sich irgendwo in Italien, möglicherweise in Siena, und glotzt im wahrsten Sinne des Wortes auf ein gotisches Meisterwerk. Zwar gibt es Begriffe wie "heraldik" und "weißestn marmors parade", aber der Betrachter dürfte wohl eher ein "Kölscher Jung" sein, dem die Bild-"ALLEGORIEN" nur eines sagen: "nix wie mädels / mit blanken möpsn auffe reliefkacheln".
Da prallen im Gedicht sprachlich zwei Welten aufeinander, die nichts gemeinsam haben - außer einem Sachverhalt: "säuberlich schädeldecken (caput mortuum)". Denn gestorben wird zu jeder Zeit. Und daher kann Kling sein Gedicht auch am Schluss als "grabungsbericht" bezeichnen.
Wenig Spielraum für Interpretation
Thomas Kling macht es den Lesern seiner ersten Gedichtbände nicht immer leicht. Die Sprachexperimente und die Assoziationsbreite vieler Texte lassen wenig Spielraum für klare Interpretationen. Doch in den 1990er Jahren wendet sich Kling Motiven aus der klassischen Dichtung zu.
Seine Nachdichtungen von Catulls Liebeslyrik gehören sicher zum Feinsten, was bislang an Übersetzung angeboten wurde. Die enorme Sinnlichkeit Catulls - die auch ganz schön derb sein kann! - holt Kling mit großer poetischer Kraft ins Deutsche hinüber. Völlig entstaubt kann so das Lesen lateinischer Dichtung echten Lustgewinn bringen.
Aber Thomas Kling widmet sich auch der lateinisch-römischen Mythologie. So hat er einen Gedicht-Zyklus zu "Actaeon" geschrieben. Der Jäger Aktaion beobachtet Diana beim Nacktbaden. Als die Göttin dies merkt, verwandelt sie Aktaion in einen Hirschen, der sodann von seinen eigenen Hunden zerrissen wird. Ein schlimmes Ende für einen schlichten Voyeur.
Das Publikum verzaubern
"Das Gedicht baut auf die Fähigkeiten der Leser / Hörer, die denen des Surfens verwandt zu sein scheinen, Lesen und Hören - Wellenritt in riffreicher Zone." Mit diesen Worten hat Thomas Kling einmal das Wesen seiner Dichtung beschrieben. Wie nur wenige Lyriker baut er von vornherein auf seine Leser- und Zuhörerschaft. Man kann sagen, dass seit den 1990er Jahren der Dichter Lyrik schreibt, die sein Publikum verzaubern soll: Man selbst soll das "Sprach-Surfen" erlernen, um sich so geschickt auf den reichen Flutwellen der deutschen Sprache zu bewegen.
Lyrik, so Kling, ist "kennungsdienst". Der Autor bietet seine Dienste dem Leser an, damit er die "kennung" seiner eigenen Sprache besser begreife. Mehr kann man von einem Dichter nicht verlangen! Thomas Klings "Gesammelte Gedichte" sind ein prallvolles Schatz- und Schmuckkästchen deutscher Sprache, das man besitzen sollte. Auch deswegen, weil man mit dieser Geste den toten Dichter ehrt.
Hör-Tipp
Ex libris, Sonntag, 23. juli 2006, 18:15 Uhr
Mehr dazu in Ö1 Programm
Download-Tipp
Ö1 Club-DownloadabonenntInnen können die Sendung nach der Ausstrahlung 30 Tage lang im Download-Bereich herunterladen.
Buch-Tipp
Thomas Kling, "Gesammelte Gedichte. 1981-2005", DuMont Verlag 2006, ISBN 3832179771