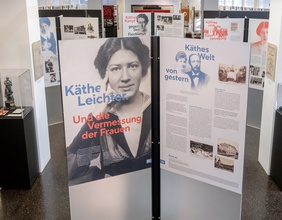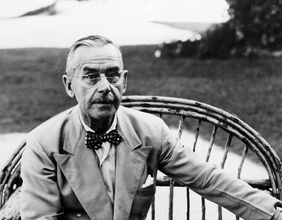Das Übel Grundschleppnetz-Fischerei
Meeresfische in Not
Seit kurzem unterliegt die kommerzielle Hochsee-Fischerei teilweise strengen Regeln. Tiefseebiologen plädieren für mehr Schutzmaßnahmen, um bekannte Fisch-Arten vor dem Aussterben zu bewahren. Sie wollen auch schützen, was noch zu entdecken ist.
8. April 2017, 21:58
Mehrere Tiefseefische nahezu ausgestorben
Matthew Gianni, der Mitbegründer der in Amsterdam ansässigen Deep Sea Conservation Coalition, hat Grund zum Feiern: Ein Beschluss von großen Fischerei-Nationen (bei einem Treffen in Chile Anfang Mai) bedeutet de facto das Ende der Schleppnetze im Südpazifik.
Zum ersten Mal ist nun kommerzielle Fischerei auf einem Teil der Hochsee, auf der traditionell eine gewisse Wildwest-Mentalität herrscht, strengen Regeln unterworfen.
Tiefseeforscher prangern Grundschleppnetze seit Jahren als die zerstörerischste aller Fischerei-Methoden an. Dabei wird Leben über Strecken von hunderten Kilometern unwiderruflich ausgelöscht.
Vom seichten Gewässer in die Tiefe
Was unter Tiefsee zu verstehen ist, hängt davon ab, wer davon spricht. Als geografischer Begriff sind damit die Tiefen jenseits von 500 Metern gemeint. Als rechtlicher Begriff versteht man darunter die so genannte Hochsee bzw. die internationalen Gewässer. Diese befinden sich außerhalb der 1982 von den Vereinten Nationen festgelegten 200-Meilen-Zone, die jeweils zum Hoheitsgebiet eines Küstenstaates gehört. Internationale Gewässer unterliegen kaum Bestimmungen oder Gesetzen. Deshalb ist das Abkommen über den Schutz der Tiefsee im Südpazifik von so großer Bedeutung.
Da seichte Gewässer zunehmend überfischt sind, haben in den letzten Jahren immer mehr kommerzielle Fischer die Tiefsee entdeckt. Um 2000 wurde Forschern klar, welches Ausmaß an nicht wiedergutzumachendem Schaden angerichtet wurde, sagt Selina Heppell, Meeresbiologin an der Universität von Oregon.
Tiefseefische meist unschätzbar alt
Selina Heppell hat eine griffige Begründung parat, warum man Tiefseefische vom Speisezettel streichen sollte: Iss nie etwas, das älter ist, als deine Großmutter. Das ist nicht im übertragenen Sinn gemeint. Einige Steinfischarten können bis zu 200 Jahre alt werden. Der bei Australien und Neuseeland beheimatete Granatbarsch erreicht 150 Jahren.
Granatbarsche leben in großen Schwärmen. Fischer können also in wenigen Minuten Mengen von zwischen 10 und 50 Tonnen emporziehen. Die Bestände sind seit 1980, als die Jagd auf die Barsche begann dramatisch geschrumpft.
Blick in die Zukunft kaum möglich
Eine kanadische Forschergruppe stellte kürzlich fest, dass mehrere Tiefseefische im Nordwestatlantik dem Aussterben gefährlich nahe kommen. Das Zählen von Fischen ist selbst in seichten Gewässern keine exakte Wissenschaft. Die Fehlerquote kann plus/minus 20 Prozent betragen. Tiefseefische leben in einem unzugänglichen Habitat. Da es an wissenschaftlicher Grundinformation über den Lebenszyklus vieler langlebiger Fische fehlt, müssen Forscher auch bei Managmentplänen zu deren Erhaltung Ungewissheiten in Kauf nehmen.
Wie unverlässlich Projektionen in die Zukunft sein können, beweist das Beispiel des Kabeljau. Nachdem die Bestände dieses beliebten Speisefisches in den 90er Jahren im westlichen Nordatlantik drastisch abnahmen, verhängten die USA und Kanada ein permanentes Fangverbot. Damals hegten viele die Hoffnung, dass die Kabeljaubestände sich bald erholt haben würden. Diese Hoffnung hat sich bis heute nicht bestätigt.
Mehr zu Tiefsee-Spezien in science.ORF.at
Hör-Tipp
Dimensionen, Montag, 21. Mai 2007, 19:05 Uhr
Links
The Deep Sea Conservation Coalition
Greenpeace - Tiefsee