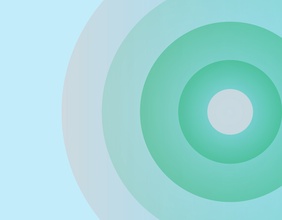Zeit und Arbeitsdisziplin
Blauer Montag
"Zeit ist Geld", hören wir von Kindesbeinen an, doch seit wann und warum nehmen wir die Zeit überhaupt als Stress wahr? Antworten auf diese Frage gibt ein neu übersetzter Essay des 1993 verstorbenen britischen Historikers Edward P. Thompson.
8. April 2017, 21:58
Schmiede, Drucker, Kohlenarbeiter und Weber feierten ihn, und in manchen britischen Industriegegenden hielt er sich bis weit ins 20. Jahrhundert: der Blaue Montag. Viktorianischen Puritanern war dieser Tag, an dem nicht oder nur "mit halber Kraft" gearbeitet wurde, ein Dorn im Auge, sahen sie in ihm doch den Inbegriff des lasterhaften Müßiggangs und der alkoholischen Exzesse.
Für die Handwerker in der Heimarbeit und in den Kleinbetrieben jedoch war das "blau machen" einer der letzten Akte des Widerstands gegen ein strikt nach den Regeln der Effizienz arbeitendes Zeitregime; ein Regime, das, wie Edward P. Thompson in seinem bereits vor 40 Jahren erstmals erschienenen Essay überzeugend argumentiert, mit der Industriellen Revolution begann und nachhaltig unsere Vorstellungen von Arbeitsdisziplin auf den Kopf stellen sollte.
Von Sonnenauf- bis -untergang
Bis in die frühe Neuzeit herauf hatte man die Arbeitstage noch abseits der strengen Vorgabe des Uhrzeigers gestaltet. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang bildeten die logischen Einschnitte des Tages, die saisonalen Anforderungen der Landwirtschaft gaben den Takt der Arbeit vor.
In dem Maße, in dem der Arbeitsprozess jedoch komplexer wurde, wurde auch das Bedürfnis nach präziserer Zeitmessung stärker. Die zunehmende Arbeitsteilung und der wachsende Einsatz von Maschinen erforderte eine bessere Synchronisation einzelner Abläufe und der daran beteiligten Personen. Wand- und Taschenuhren - lange Jahre Zeitmesser von höchst zweifelhafter Genauigkeit - werden im 17. Jahrhundert technisch verbessert und finden, so der Sozialhistoriker, nicht zufällig in dem Moment allgemeine Verbreitung, in dem die Industrielle Revolution ihren Siegeszug antritt.
Zeit der Willkür
Hatten im vorindustriellen Zeitalter Phasen höchster Arbeitsintensität mit Phasen des Müßiggangs abgewechselt, so sollte in den Fabriken nach 1700 durchgängig Arbeitseffizienz herrschen – und das, wie in den englischen Crowley-Eisenwerken, gleich 13,5 Stunden am Tag. Dort sorgte ein ausgefeiltes System von Zeitplänen und Verordnungen, Aufsehern und Denunzianten, Kontrollkarten und Strafandrohungen dafür, die Arbeiter zu höchstmöglicher Disziplin anzuhalten - und ihnen klar machen, dass die Herrschaft über die Zeit einzig und allein in der Hand des Firmenchefs lag.
Dass die Fabrikanten diese Herrschaft zum Teil recht willkürlich ausübten, belegen Klagen wie jene eines Arbeiters aus Dundee im Jahr 1887:
Die Uhren in der Fabrik wurden oft morgens vor- und abends nachgestellt, und anstatt Instrumente der Zeitmessung zu sein, wurden sie zum Deckmantel für Betrug und Unterdrückung. Obwohl dies unter den Arbeitern bekannt war, wagten sie nicht, etwas zu sagen; jeder scheute sich, eine Uhr zu tragen, denn es war nicht ungewöhnlich, dass einer entlassen wurde, der sich anmaßte, zu viel von der Wissenschaft der Uhrzeit zu verstehen."
Neues Zeitregime
In einer ersten Phase leistete die Arbeiterschaft noch Widerstand gegen das neue Zeitregime. Doch schon bald hatte sie, so das ernüchterte Fazit des Historikers, die geänderten Vorgaben internalisiert – und ging vom Kampf gegen die Zeit zum Kampf um die Zeit über.
Der ersten Generation Fabrikarbeiter wurde die Bedeutung der Zeit von ihren Vorgesetzten eingebläut, die zweite Generation kämpfte in den Komitees der Zehn-Stunden-Bewegung für eine kürzere Arbeitszeit, die dritte kämpfte für Überstunden- und Feiertagszuschläge. Sie hatten die Kategorien ihrer Arbeitgeber akzeptiert und gelernt, innerhalb dieser Kategorien zurückzuschlagen. Sie hatten ihre Lektion – Zeit ist Geld – nur zu gut begriffen.
Fremd- und selbstbestimmte Einteilung
Wenn der Puritanismus ein notwendiger Bestandteil jenes Arbeitsethos war, das es der industriellen Welt ermöglicht hat, aus der Armut auszubrechen, dann - so Thompsons Überlegung - könnte der nachlassende Druck der Armut vielleicht auch zu einer langsamen Zersetzung des puritanischen Zeitverständnisses führen.
Thompsons Utopie der Aufhebung der Trennung zwischen fremdbestimmter Arbeitszeit und selbstbestimmter Privatzeit dürfte im Moment in Erfüllung gehen - wenn auch nicht so, wie Thompson es sich wohl gewünscht hätte. Neue Kommunikationstechnologien und flexible Arbeitszeitmodelle haben es den Angestellten ermöglicht, ein Stück weit die Herrschaft über die Zeit von den Unternehmern zurückzuerobern. Solange der Geschäftsoutput stimmt, sind heute selbst wieder Blaue Montage möglich. Ob mit der Verlagerung der Verantwortung über die Zeit aber tatsächlich auch die alten Zeitregimes abgeschafft sind, tatsächlich auch ein Stück Freiheit zurückgewonnen wurde, bleibt offen.
Service
Edward P. Thompson, "Blauer Montag. Über Zeit und Arbeitsdisziplin", aus dem Englischen übersetzt von Lars Stubbe, Edition Nautilus