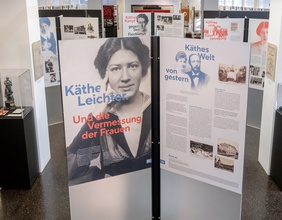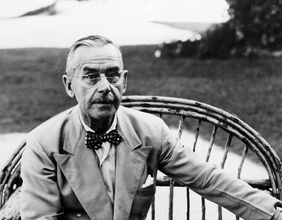Die hohe Kunst der Spieloper
Tot oder lebendig?
Liegt es an der Naivität der Stücke oder an fehlenden Bühnentypen, dass die einst so beliebten Opern von Lortzing & Co. kaum mehr gespielt werden? Anspruchsvolle Unterhaltung ist die schwierigste aller Disziplinen im Bereich der darstellenden Kunst.
8. April 2017, 21:58
Die Deutsche Spieloper: Tot oder lebendig? Ein etwas provokanter Titel. Und auch nicht wirklich eindeutig zu beantworten. An den ganz großen Häusern ist es mit diesem Repertoire zur Zeit wahrscheinlich wirklich vorbei. An der Volksoper aber schien mit Beginn der Ära Rudolf Berger die Welt auf diesem Gebiet gerade wieder in Ordnung zu kommen.
Die Premiere von Friedrich von Flotows "Martha" im Herbst 2003 wurde jedenfalls zu einem großartigen Publikumserfolg, es mussten sogar noch zusätzliche Vorstellungen eingeschoben werden. Was mehr kann sich ein Operndirektor zu seinem Einstand also wünschen? Vor allem, wenn der Erfolg durchaus auch die szenische Komponente dieser Produktion mit eingeschlossen hat, was heute wahrlich keine Selbstverständlichkeit darstellt. Dennoch ist man diesen Weg nicht weiter gegangen, das Haus am Gürtel schlitterte in die Krise und ab der nächsten Spielzeit versucht mit dem renommierten Kammerschauspieler Robert Meyer ein neuer Direktor sein Glück.
Die schwierigste aller Disziplinen
Dieses Glück wird wohl nicht allein vom Genre der Deutschen Spieloper abhängen, dennoch, weitere Versuche wären durchaus wünschenswert. Schließlich haben sich Generationen von Opernbesuchern nicht nur an den melodischen Einfällen von Lortzing & Co erfreut, sondern sich durchaus auch über die komischen Figuren und Situationen dieser Stücke amüsiert.
Allerdings war anspruchsvolle Unterhaltung schon immer die schwierigste aller Disziplinen im Bereich der darstellenden Kunst. Diese Stücke mit ihrer oft tatsächlich vorhandenen "Biedermeierlichkeit" aber nun in andere Zeiten, sprich in die Gegenwart, oder in die heute so beliebten Fünfzigerjahre zu versetzen, wird einer Wiederbelebung jedoch garantiert keine Lebensimpulse geben, im Gegenteil. Da muss ein versierter Regisseur beziehungsweise Bearbeiter sich schon diffizilerer Mittel bedienen.
Kaum internationale Erfolgsgeschichte
Dies gilt ebenso für die Interpreten, wobei mit Ausnahme von "Martha" (die vor allem im italienischen Raum einst sehr beliebt war - der Lyonel eine Glanzrolle von Caruso!) diese Stücke kaum eine internationale Geschichte haben. Sängerinnen und Sänger - insbesondere nicht deutschsprachige - müssen sich auf derartige Rollen daher ganz besonders vorbereiten, Klischees vermeiden und sollten ihre Partien auch keineswegs nur vordergründig-komisch anlegen.
Ein gutes Beispiel, wie sorgfältig und dabei keineswegs steril zum Beispiel Lortzing gesungen werden kann und muss, gibt eine im "Lortzing-Jahr" 2001 (150. Todestag, 200. Geburtstag) in Berlin entstandene Arien-CD mit Thomas Quasthoff, auf der er unter anderem sechs berühmte Lortzing-Nummern mit größter Delikatesse singt, am Pult adäquat von Christian Thielemann und dem Orchester der Deutschen Oper Berlin begleitet. Wie schade, dass eine solche Kombination nie die Chance auf eine Bühnen-Realisierung haben konnte.
Exemplarische Einspielungen
So bleiben dem interessierten Konsumenten hauptsächlich historische Einspielungen, wenn er sich für diese ganz spezifisch deutsche Form der Opernkunst interessiert. Robert Heger etwa hat exemplarische Einspielungen von Flotow-, Lortzing- und Nicolai geleitet, dazu kommen Gesamtaufnahmen und Einzeleinspielungen mit Maria Cebotari, Erna Berger, Lotte Lehmann, Peter Anders, Marcel Wittrisch, Richard Tauber, Fritz Wunderlich, Gottlob Frick, Leo Schützendorf, Georg Hann und Josef Greindl bis zu Caruso und Gigli.
Die Palette ist jedenfalls äußerst umfangreich und belegt deutlich, dass die Ohrwürmer aus diesen Opern jahrzehntelang zu den Bestsellern aller Wunschkonzerte gezählt haben.
Hör-Tipp
Apropos Oper, Dienstag, 23. Jänner 2007, 15:06 Uhr
Links
Wikipedia - Spieloper
Wikipedia - Albert Lortzing
Wikipedia - Friedrich von Flotow
Volksoper Wien