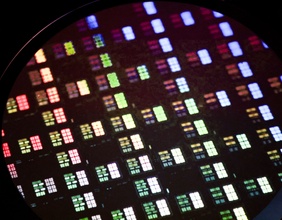Aphorismen von Nicolás Gómez Dávila
Das Leben ist die Guillotine der Wahrheiten
Ein erfrischender Provokateur war er, einer der originelleren Vordenker der Gegenmoderne. Nachdem er lange als Geheimtipp gehandelt wurde, liegt nun eine Art Best-Of-Band des kolumbianischen Philosophen Nicolás Gómez Dávila vor.
8. April 2017, 21:58
Der Aphorismus ist das bevorzugte Ausdrucksmittel Nicolás Gómez Dávilas. Der 1994 verstorbene Kolumbianer hat zeitlebens nur einige wenige Bände veröffentlicht, seinen vielleicht wichtigsten, "Notas", überhaupt nur im Privatdruck. Ob er mit seinen Schriften die Öffentlichkeit erreiche, war dem bekennenden Reaktionär egal. Die rabiate Kritik an der Moderne mit ihrem allzu optimistischen Menschenbild steht im Zentrum von Gómez Dávilas Aphoristik.
Die gegenwärtige Menschheit hat den Mythos eines vergangenen Goldenen Zeitalters durch den eines zukünftigen Zeitalters aus Plastik ersetzt.
Der Mensch ändert sich nicht
Wie alle Konservativen traut auch Gómez Dávila dem Menschen nicht. Was immer sich Marxisten, Republikaner, liberale Demokraten einbilden mögen: Im Innersten, so Gómez Dávilas Überzeugung, ändert der Mensch sich nicht. In all seinen historischen Verkleidungen, davon ist der Philosoph überzeugt, bleibt der Mensch, was er immer war: sündhaft, rücksichtslos, egoistisch, brutal.
Reaktionär sein heißt verstehen, dass der Mensch ein Problem ist, für das es keine menschliche Lösung gibt.
Und an anderer Stelle schreibt Gómez Dávila:
Da ich mich selbst kenne, wird mich niemand dazu bringen, die menschliche Natur freizusprechen.
Gegner der modernen Massengesellschaft
Wer so denkt, wird dem Fortschrittspathos der Moderne, wird der liberalen Demokratie wenig abgewinnen können. Die Aphoristik Gómez Dávilas strotzt vor Sottisen gegen die moderne Massengesellschaft.
Der schlimmste Zustand der Gesellschaft: Die Herren werden nicht zum Befehlen erzogen.
Und die Untertanen nicht zum Gehorchen. Solche Theoreme sind nicht nach jedermanns Geschmack, sind eine Provokation für das demokratisch aufgeklärte Bewusstsein. Vieles von dem, was Nicolás Gómez Dávila in epigrammatischer Verknappung von sich gibt, erinnert an die kulturpessimistischen Ressentiments europäischer Rechtsradikaler der 1920er und 1930er Jahre.
Der städtische Asphalt bringt nur Demokraten, Bürokraten und Huren hervor.
Ein Werk aus Fußnoten
Hätte Gómez Dávila nicht mehr zu bieten als zivilisationskritische Ausfälligkeiten dieser Art, kein Hahn würde zwölf Jahre nach seinem Tod noch nach ihm krähen. Was den Kolumbianer auch für Feingeister à la Botho Strauß interessant macht, ist die postmoderne Doppelbödigkeit seines Oeuvres:
Sein ganzes Werk, so Gómez Dávila, bestehe lediglich aus Fußnoten, korrekter gesagt: aus Glossen zu einem imaginären Text, der das eigentliche Werk darstellt. Dieser Text ist inexistent. Lesen können wir ausschließlich die Glossen, also Gómez Dávilas Aphorismen, denen der Haupttext gewissermaßen inhärent ist. Eine elegante Konstruktion.
Was der Schriftsteller als erstes erfindet, ist die Person, die seine Werke schreiben wird.
Geistige Heimat katholische Kirche
Als intellektuelle "Schutzpatrone" nennt Nicolás Gómez Dávila Michel de Montaigne und Jakob Burckhardt. Seine geistige Heimat, so hat der Philosoph immer wieder betont, sei die katholische Kirche.
Nichts besticht mich am Christentum so sehr wie die wunderbare Unverschämtheit seiner Doktrinen.
Dabei macht Gómez Dávila kein Hehl daraus, dass er mit linkskatholischen Konzeptionen wenig anzufangen weiß.
Der progressive Katholik sammelt sich seine Theologie aus dem Müllhaufen der protestantischen Theologie zusammen.
Radikal antimodernes Denken
Nicolás Gómez Dávila war eine provokante Erscheinung. Er propagierte ein radikal antimodernes Denken, das derart unverfälscht wohl nur in den Herrenreiter-Milieus Lateinamerikas überdauern konnte.
Die Vergangenheit, die der Reaktionär preist, ist keine historische Epoche, sondern konkrete Norm. Was der Reaktionär an anderen Jahrhunderten bewundert, ist nicht ihre immer elende Wirklichkeit, sondern die ihnen eigentümliche Norm, die nicht befolgt wurde.
Klingt irgendwie edel. Gómez Dávila kann auch anders:
Das Volk ist zivilisiert, so lange es noch Spuren einer oberen Klasse mit der Peitsche in der Hand gibt.
Epigrammatische Provokationen
Liest man sich durch den Gómez-Dávila-Band der "Anderen Bibliothek", fragt man sich, worauf der Nimbus des Kolumbianers eigentlich beruht. Sicher, es finden sich elegante Apercus in diesem Band, erhellende Einsichten, dann und wann auch Sätze von kristallener Klarheit. Im Großen und Ganzen aber verlässt Gómez Dávila mit seinen epigrammatischen Provokationen kaum je die ausgelatschten Pfade der europäischen Zivilisationskritik.
Reaktionäre Literatur soll es geben, keine Frage. Es soll ja alles irgendwie geben. Nur: Wenn schon reaktionäre Aphoristik, dann Emile Cioran. Der war um Klassen origineller.
Hör-Tipp
Kontext, jeden Freitag, 9:05 Uhr
Buch-Tipp
Nicolás Gómez Dávila, "Das Leben ist die Gouillotine der Wahrheiten. Ausgewählte Sprengsätze", hrsg. von Martin Mosebach, aus dem Spanischen übersetzt von Thomas Knefeli u. a., Eichborn-Verlag, ISBN 978-3821845722