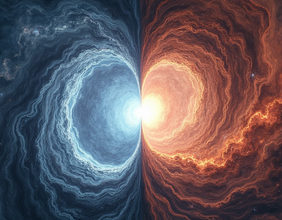Rückfall ins 17. Jahrhundert
Philosophen warnen vor neuen Privatkriegen
Philosophen warnen vor einer Re-Privatisierung des Krieges.
8. April 2017, 21:58
Philosophen warnen vor einer Re-Privatisierung des Krieges. Hätten Privatfehden mit dem Westfälischen Frieden nach dem Dreißigjährigen Krieg 1648 ein vorläufiges Ende gefunden, indem der Staat damals das Monopolrecht auf Kriege bekam, seien mittlerweile nicht nur in Afrika private Bandenkriege wieder in den Vordergrund gerückt. Auch im Irak stellten private Militärfirmen mit 30.000 Einsatzkräften nach den regulären US-Truppen bereits das zweitgrößte Kontingent, sagte der Wiener Philosoph Rudolf Burger im Rahmen einer Plenarveranstaltung am Europäischen Forum Alpbach. Titel der Veranstaltung vom 19. August 2006: Retheologisierung der Politik?
Neue Söldner
Eine der größten Privatfirmen, die im Irak private "Sicherheitskräfte" zur Verfügung stellen, ist laut internationalen Zeitungsberichten etwa die US-Firma Blackwater. Die Rede ist in diesen Berichten durchwegs von "neuen Söldner". Die angebotenen "Dienstleistungen" decken nahezu das komplette Spektrum von Armeen, Polizei und Geheimdiensten ab. Kritiker behaupten, dass die Firmen mitunter sogar Folterpraktiken übernähmen, die den staatlichen US-Militärs auf Grund des internationalen Rechts verboten seien.
Historischer Rückschritt
Auch die Re-Militarisierung der Religionen wertet Burger als eine Rückkehr in die Zeit des Dreißigjährigen Krieges zwischen Katholiken und Protestanten. Noch vor 30 Jahren hätten sich die Kriege praktisch ausschließlich um Ideologien gedreht. "Die ideologischen Hauptkampflinien verliefen nicht entlang der religiösen Fronten", betonte Burger. Mit dem Niedergang des Kommunismus habe sich die Welt aber endgültig "für eine bürgerliche, demokratische Gesellschaft mit mehr oder weniger abgefederten Marktwirtschaften entschieden". Selbst die radikalsten Globalisierungsgegner verlangten lediglich eine Steuer auf Kapitalgewinne, worum man kaum mit Waffen streiten könne. Die prophetische Geschichtsphilosophie habe damit ein Ende erreicht, glaubt Burger.
Allgemeine Radikalisierung
Der sich heute wieder abzeichnenden Kampf der Religionen basiere nicht nur auf der Radikalisierung des Islams. Auch im Judentum gebe es fundamentalistische Entwicklungen in der Orthodoxie, ebenso wie im Christentum. In den USA hätten protestantische Bewegungen schon seit Jahren den nächsten Weltkrieg gegen den Islam vor Augen. Europa dagegen habe aus den früheren Religionskriegen erkannt, dass diese Konflikte nicht lösbar seien. Diese Erfahrungen fehlten den USA und dem Islam, so Burger.
Allerdings erinnerte Peter Markl, Professor für analytische Chemie an der Universität Wien, daran, dass selbst in Österreich nach wie vor die Religion massiv in die Politik einwirke - "etwa in der Forschung in der Frage, wie Leben entsteht". Und auch Burger gestand ein, dass schon die Debatte über Grundwerte und eine Verfassung "zwar vernünftig sein mag, aber nicht demokratisch ist, weil sie alle Generationen an die Entscheidung die Erfahrungen einer Generation bindet".
Zwischen Religion und Politik
Wie man der neuen Re-Militarisierung der Politik entgegen wirken kann, darüber waren die Meinungen der Philosophen in Alpbach jedoch geteilt. Die Religionswissenschafterin und Wiener Rabbinerin Eveline Goodman-Thau glaubt, dass man alle Religionen auf einen Nenner bringen müsste. Ziel müsse es sein, "womöglich auf Basis von Metaphern anstelle der Bibel gemeinsame menschliche Werte zu definieren". "Wir müssen die Religionen vor ihrem eigenen Missbrauch bewahren", so Goodman-Thau.
Burger dagegen vertrat die Position, dass, so lange Religion herrsche, die "Demokratie ein Sakrileg" sei. Der Kern der europäischen Aufklärung sei der Nihilismus, "dass der Himmel leer ist und wir zur Freiheit verdammt sind". Ein demokratischer Staat auf Basis einer Religion habe "größte Schwierigkeiten", wenn ein maßgeblicher Anteil dieser Bevölkerung diese Religion nicht teilt.
Goodman-Thau hielt dem entgegen, dass "alle Aufklärung Europa nicht vor den totalitären Regimes des 20. Jahrhunderts und auch nicht vorm Irak-Krieg bewahrt" habe. In Israel gebe es deshalb Bestrebungen, "die einen Weg wollen, der Religion und Demokratie wieder verbindet, weg vom europäischen Humanismus". Und auch der britische Politologe John Dunn von der Universität Cambridge ist der Ansicht: "Wenn die Demokratie die Religion verbannt, zerstört sie sich selbst".
Glaube die Mehrheit der Bevölkerung an eine Religion, müsse ein demokratischer Staat automatisch diese Religion vertreten. Daher werde es die essenzielle Aufgabe der Politik sein, Kompromisse zu finden wie die unterschiedlichen Demokratien zusammenleben können. "Sonst enden wir damit, dass wir uns alle umbringen", sagte Dunn. Die Demokratie hält er "trotz all ihrer Schwächen noch immer für den besten Weg, diesen Konsens zu suchen".
Mehr zum Thema Alpbach in oe1.ORF.at
Suche nach Gewissheit
Neoliberale kritisieren Sicherheitsdenken
Penningers Kritik am Wissenschaftsstandort
Die Uniformierung unserer Städte
Mehr zu den Alpbacher Technologiegesprächen von Donnerstag, 24. August bis Samstag, 26. August 2006 täglich in science.ORF.at
Hör-Tipps
Dimensionen, Montag, 28. August 2006, 19:05 Uhr
Von Donnerstag, 17. August bis Samstag, 2. September 2006 berichten die Ö1 Journale und "Wissen aktuell" über das Europäische Forum Alpbach.
Download-Tipp
Ö1 Club-DownloadabonnentInnen können die Sendung "Dimensionen" vom Montag, 28. August 2006, 19:05 Uhr nach der Ausstrahlung 30 Tage lang im Download-Bereich herunterladen.
Veranstaltungs-Tipps
Europäische Forum Alpbach 2006, "Suche nach Gewissheit und Sicherheit", Donnerstag 17. August bis Samstag, 2. September 2006, Alpbach
Alpbacher Technologiegespräche, Donnerstag, 24. August bis Samstag, 26. August 2006, Kongress Zentrum Alpbach
Links
Universität für angewandte Kunst - Rudolf Burger
Universität Wien - Peter Markl
Hagalil - Eveline Goodman-Thau
Wikipedia - Blackwater (engl.)
Wikipedia|Dreißigjähriger Krieg
Blackwater
Europäisches Forum Alpbach