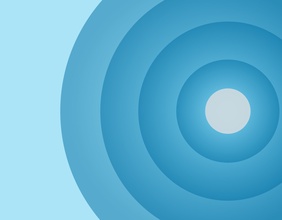Indianische Geschichte mit Lücken
Was bitte sind Geisterkämpfer?
Es gilt: Im Krieg sind alle Mittel erlaubt. Wenn es also Top-Spurenleser gibt: her damit! Meisterschützen? Jawoll! Lautlose Kämpfer? Hervorragend! Und eine nicht für alle verständliche Sprache? Die werden Funker! Passt alles, oder?
8. April 2017, 21:58
Man weiß, dass die US-Army im Zweiten Weltkrieg, besonders nach Pearl Harbour, Navajo als Funker eingesetzt hat, die kriegswichtige Nachrichten in ihrer Muttersprache durch den Äther geschickt haben. Man bewundert diesen einfachen Kunstgriff, der die gegnerischen Entschlüssler mit Sicherheit in den Wahnsinn getrieben hat.
Aber weiß man auch, dass jedem Navajo ein Officer zugeteilt war, der eine Gefangennahme der menschlichen Verschlüsselungsmaschine per Genickschuss verhindern sollte?
Die lautlose Kriegskunst der Natives
Auch im Ersten Weltkrieg haben die US-Army und die Kanadische Armee selbstverständlich indianische Soldaten aufgenommen. Es war ein "Quasi-Geschäft auf Gegenseitigkeit": Die jungen Native People erhofften auf diese Weise für ihre Nation Anerkennung, da sie sich ja für die Sache der Regierung eingesetzt haben. Und die Armee setzte auf die besonderen Fähigkeiten der Natives: das sich lautlose Fortbewegen in schwierigem Gelände, ihre Kunst, Fährten zu lesen, ihre unendliche Geduld beim Warten auf den einzig möglichen und für den Gegner letalen Schuss, sowie ihre Zielsicherheit.
Die Deutschen fürchteten die Indianer und nannten sie Geisterkämpfer, weil sie sich lautlos in die Schützengräben schlichen und ihre Feinde massakrierten und weil sie sich so unsichtbar machen konnten, dass ihre Verstecke, von wo aus sie zielgenau und über weite Entfernungen den Tod schickten, selbst von den stärksten Feldstechern nicht ausgemacht werden konnten.
Der lange Weg zweier Cree-Indians
Einer dieser indianischen Geisterkämpfer war Corporal Francis Pegahmagabow - ein Ojibwe, den seine Kameraden Peggy nannten. Er ging als höchst dekorierter Native-Kämpfer aus diesem Krieg nach Hause. Er und seine Kameraden waren das Vorbild für die beiden jungen indianischen Männer, deren Geschichte der kanadische Autor Joseph Boyden in seinem Roman "Der lange Weg" oder "Three Day Road", wie der Roman im Original heißt, meisterhaft erzählt.
Drei Tage dauert nämlich die Fahrt vom Bahnhof, wo der eine der beiden - einbeinig und morphiumsüchtig - aus dem Krieg nach Hause kommt und von seiner Tante, der letzten Schamanin seines Volkes, abgeholt wird. Sie versucht ihm durch Geschichten-Erzählen eine Möglichkeit zu geben, mit den Gespenstern seiner Vergangenheit ins Reine zu kommen. Er versucht, den Irrsinn, in den er und sein Freund hineingeraten sind, zu begreifen. Und beide stehen fassungslos vor dem, was die Weißen im Leben wichtig finden.
Erfolgsautor mit indianischen Wurzeln
Joseph Boyden, dessen Vorfahren Cree, Schotten, Iren und Franzosen waren, hätte auch auf Quellen in seiner eigenen Familie zurückgreifen können, denn sowohl sein Onkel als auch sein Großvater als auch sein Vater haben in den beiden Weltkriegen gekämpft. Letzterer war einer der höchst dekorierten Ärzte des British Empire. Sein Roman erregte großes Aufsehen, wurde mehrfach ausgezeichnet und wird wohl einmal verfilmt werden.
Vielleicht bringt er auch Historiker dazu, die große Lücke, die zwischen der endgültigen Unterwerfung in den 1890ern und dem Aufflackern des Widerstands in den späten 1960ern klafft, aufzuarbeiten.
In seinem jüngsten Roman "Durch dunkle Wälder" greift er ein weiteres heikles Thema der indianischen Realität auf: das Leben der Gegenwart. Die alten Regeln gelten nicht mehr, die über Jahrtausende geltende, auf Respekt beruhende Lebensordnung hat alles Recht verloren - angesichts der alles beherrschenden Gier, die die Lebensweise der Städte beherrscht. Wo liegt unsere indianische Zukunft, fragt Joseph Boyden. Wirklich bei unseren Wurzeln? Wirklich in den Wäldern?