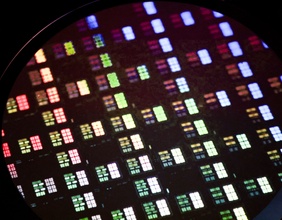Schriftsteller, die in kein Schema passen
Überblick
Ihre Werke sind bekannt, was sie zu Außenseitern macht ist, dass sie in kein literarisches Schema passen: Jakob Lenz, Friedrich Hölderlin, Georg Büchner, Fritz von Herzmanovsky-Orlando, Franz Kafka, Jura Soyfer, Hertha Kräftner und Konrad Bayer.
8. April 2017, 21:58
Jakob Michael Reinhold Lenz war immer ein Außenseiter
Die Werke von Jakob Michael Reinhold Lenz (1751-1792), Friedrich Hölderlin (1770-1843), Georg Büchner (1813-1837), Fritz von Herzmanovsky-Orlando (1877-1954), Franz Kafka (1883-1924), Jura Soyfer (1912-1939), Hertha Kräftner (1928-1951) und Konrad Bayer (1932-1964) haben markante, doch sehr unterschiedliche Konturen. Sie alle verbindet die Tatsache, dass sie erst spät, wenn überhaupt, einen Platz in den Literaturgeschichten erhalten haben, ja dass sie in der Literaturgeschichte nicht umgangen werden dürfen, aber eine Verlegenheit für die professionellen Literaturhistoriker sind: Sie passen nicht in die gängigen Kategorien und Zuordnungen, nicht zuletzt weil sie innovative Akzente gesetzt haben und somit in einem positiven Sinne "Unzeitgemäße" sind.
Opfer politischer Umstände
Vielfach wurde die Verbreitung der Werke dieser Außenseiter auch durch politische Umstände gehindert. Georg Büchner floh aus Hessen und starb in Zürich. Für Lenz gab es kein Unterkommen an einem der Fürstenhöfe im Deutschland des 18. Jahrhunderts, und er starb, vereinsamt und verarmt, in Moskau. Jura Soyfer schrieb seine ätzenden Satiren in der Zeit des Ständestaates; von ihm wie von Georg Büchner oder Konrad Bayer erschien zu Lebzeiten kein einziges Buch. Er starb im KZ Buchenwald an Typhus. Auch Hertha Kräftner und Konrad Bayer konnten auf dem literarischen Feld in den Anfangsjahren der Zweiten Republik kaum reüssieren.
Bekannt durch Nachlassverwalter
Die Bedeutung dieser Außenseiter für die Literatur ergab sich erst durch die Edition der Nachlässe. Alle dieser "Außenseiter" galten zwar als Geheimtipps, es bedurfte aber der Energie einzelner Herausgeber, um die Werke der Vergessenheit zu entreißen. Und das waren nicht Philologen von Beruf, sondern meistens Dichter wie etwa Ludwig Tieck für Lenz, Gustav Schwab für Hölderlin, Karl Emil Franzos für Büchner, Friedrich Torberg für Herzmanovsky-Orlando, Max Brod für Kafka, Andreas Okopenko für Hertha Kräftner und Gerhard Rühm für Konrad Bayer.
Für Jura Soyfer war es ein Tondokument, das wesentlich dazu beitrug, den Namen Soyfer bekannt zu machen, und zwar die kongeniale Lesung des Romans "So starb eine Partei" durch Helmut Qualtinger. Hätte sich Max Brod an den Auftrag Kafkas gehalten und dessen Nachlass verbrannt, so wüssten wir nichts von dessen Romanen "Amerika", "Der Prozess" und "Das Schloss". Hätte Karl Emil Franzos sich nicht so nachdrücklich um Büchners literarische Hinterlassenschaft gekümmert, wäre dessen Drama "Woyzeck" nicht auf uns gekommen, ein Stück Literatur, das einen Typus auf die Bühne brachte, dessen weltliterarische Geltung sich durchaus mit der des Ödipus oder des Hamlet vergleichen lässt. Selbst Büchners Bruder Ludwig hatte das Werk als belanglose Skizze abgetan.
Nicht abgeschlossen, aber vollendet
Mit Ausnahme von Lenz haben alle acht "Außenseiter" Unvollendetes hinterlassen, das aber in einem gewissen Sinne vollendeter ist als manches Werk, das als abgeschlossen gelten kann. Mittlerweile ist das Fragment zu einem wesentlichen Charakteristikum der Moderne geworden. Das Unabgeschlossene verbürgt nach dem Wort Adornos den Wahrheitsgehalt des Kunstwerks.
Kafkas Romane sind nicht abgeschlossen, Hölderlins späte Hymnen faszinieren gerade durch ihr "Abgebrochensein", von dem Roman der Hertha Kräftner sind spärliche, aber sehr eindringliche Skizzen vorhanden. Herzmanovsky-Orlandos exzellierte gerade in seinen kleinen Prosafragmenten: kleine Vignetten von subtiler Komik, die in ihrer Absurdität den Texten Kafkas nicht von ungefähr ähneln.
Jura Soyfer konnte seinen Roman "So starb eine Partei" nicht vollenden, aber es gibt wenig, das sich an politischem und satirischem Gehalt diesem Werk in der österreichischen Literatur an die Seite stellen lässt. Konrad Bayers Romanfragment "Der sechste Sinn" ist ein Schlüsselwerk avantgardistischer Prosa, angesichts dessen die Interpretationskünste der Kritiker wie Wissenschafter versagen, dessen Qualitäten aber bei sorgsamer Lektüre unmittelbar zur Evidenz kommen.
Von Zuschreibungen befreit
So anerkannt die Autoren heute im Gespräch über Literatur auch sind, beheimatet im literarischen Kanon sind sie nicht. Zwar wird man im Literaturunterricht auf Büchner schwer verzichten können, aber bei Lenz ist die Sache schon schwieriger. Kafka ist unumgehbar, aber von seinen Texten geht eine desorientierende Wirkung aus, mit der nur geschickte Pädagogen zurande kommen. Hölderlin und Bayer gelten als zu schwer, Soyfer wird nicht selten als zu sehr seiner Epoche verpflichtet abgetan.
Da gibt es Autoren, die in einer gewissen Weise handlicher und weniger widerborstig sind. Doch es ist unbedingt notwendig, auch diese Gegenstimmen zu hören. Die intensive Auseinandersetzung mit den "Außenseitern" soll bewusst machen, dass Literatur dann interessant wird, wenn man sie von den Zuschreibungen befreit, mit denen sie von beflissenen Literaturhistorikern bedacht wurden.