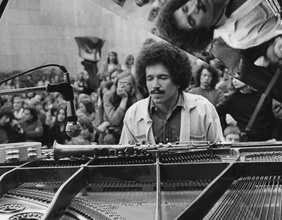Singen wurde ihm zur Predigt
Das Gewandhausorchester Leipzig
Das Gewandhausorchester kann auf eine beeindruckende Geschichte zurückblicken. Die ersten Konzerte fanden noch auf einem Dachboden statt, bis nach der Wende das heutige Gewandhausgebäude entstand.
8. April 2017, 21:58
Hat er oder hat er nicht? Hat Goethe das Gewandhausorchester in Klein-Paris gehört? Er hätte gekonnt, aber man weiß es nicht. Wenn er hat, dann hätte er aber das Große Concert gehört, als er von 1765 bis in 1768 in Leipzig studierte. So hieß das Orchester, das im Gasthof Zu den drey Schwänen konzertierte. Da waren ganze 16 Musiker am Werk. Stadtpfeifer hatte die Stadt Leipzig schon 1479 für geregelte städtische Ratsmusik engagiert.
Dachboden als Konzertsaal
Doch die eigentliche Geschichte des Orchesters beginnt erst, als auf Geheiß des Leipziger Bürgermeisters ein leer stehender Dachboden im Messehaus der Tuch-und Wollwarenhändler zum Konzertsaal ausgebaut wird, mit Senecas soundbite an der Stirnseite: res severa est verum gaudium. Für nun 32 Orchestermusiker und gleichermaßen Zuhörer galt: "Echte Freude ist eine ernste Sache". Am 28. November 1781 fand es statt, das erste echte Gewandhauskonzert.
1835 wird mit dem 26-jährigen Mendelssohn Bartholdy der jüngste aller Gewandhaus-Kapellmeister ins Amt gerufen. Nicht nur bringt er seit langer Zeit zum ersten Mal Bachs "Mathäuspassion" und "Messe in h-Moll" wieder öffentlich zu Gehör (Aufführungen im kleinen Kreis hatte es sehr wohl immer gegeben), er mutet dem Publikum auch zeitgenössische Musik zu. So werden etwa drei Schumann-Sinfonien, Schuberts "Sinfonie in C-Dur", seine eigene "Schottische und sein "Violinkonzert in D-Dur" werden vom seit 1840 als Stadtorchester geführten Ensemble uraufgeführt.
Tradition mit Akzenten
Arthur Nikisch hielt 1915 an einem Abend für Arbeiter eine Friedens- und Freiheitsfeier mit Beethovens Neunter ab. Es war Silvesterabend, und somit begründete Nikisch diese auch in Wien, von den Sinfonikern übernommene Silvestertradition, Beethovens Neunte zu spielen.
Ab 1922 leitet Wilhelm Furtwängler das Orchester und führt zwar die Beethoven-, Brahms- und Brucknertradition fort, verstört aber mit Hindemiths "Kammermusik 1912" und Strawinskys "Sacre du Printemps".
Als Bruno Walter (Kapellmeister von 1928-1933) wegen "rassischer Minderwertigkeit auf Anweisung des nationalsozialistischen sächsischen Innenministers der Zugang zur Probe verwehrt wird, wird das Orchester für lange Zeit politisches Instrument.
Nach 1945, nach Kriegsende, wird es unter Ernst Konwitschny zum Sendboten der DDR. Sein Nachfolger, der Tscheche Vaclav Neumann, dirigierte 1968, nachdem die Bruderstaaten des Warschauer Paktes im August 1968 in die CSSR einmarschiert waren, noch die Premiere von Janaceks Oper "Jenufa, reist aber aus Protest am 1. September aus Protest ab und kommt so bald nicht wieder.
Das Gewandhaus wird gebaut
Nachfolger Kurt Masur setzt den Bau eines neuen Saals durch, der 1981 gegenüber dem Operhaus am Karl Marx- (heute wieder Augustus-Platz), eröffnet wird. Auch Seneca kommt wieder zu Ehren. Wir lesen über dem Bühneneingang: "ernste Sache, und über der Kantine: "echte Freude.
Am 9. Oktober 1989 wird Kurt Masur, der 17. Kapellmeister, zum Helden der Wir-sind-das-Volk-Revolution. "Ich garantiere jedem, der sich hier befindet und sich äußert, dass ihm kein Schaden entsteht. Gemeinsam mit politischen Stellen verhindert das SED-Mitglied Masur, dass auf Demonstranten geschossen wird. 1996 legt er der Revolutionsheld sein Amt zurück: "Ich werde nur noch gebraucht, um abzubauen, was ich aufgebaut habe.
Sprechende Musik
Als Nachfolger kam der aus Schweden gebürtige Herbert Blomstedt. Dessen 17 Vorgänger im Amt waren bei ihrem Amtsantritt durchschnittlich 40 Jahre alt gewesen, 53 beim Abtritt. Blomstedt schied nach sieben Jahren und 486 Konzerten, einen Monat vor Vollendung seines 78. Lebensjahres, aus dem Amt.
Sein Credo: "Die Musik soll sprechen. Ich sehe meinen Auftrag darin, dass die Musik möglichst viel sagt, ich möglichst wenig. Der als Sohn eines schwedischen Adventistenpfarrers und einer Pianistin Geborene stand vor der Wahl: Religion oder Musik? "Er hat beides gewählt, so der mit Blomstedt seit 30 Jahren befreundete dänische Schriftsteller John Fellow bei seiner Festrede zur Verabschiedung am 1. Juli 2005.
Blomstedt setzte neben den Hauskomponisten (Beethoven, Haydn, Mendelssohn, Brahms oder Bruckner) auch bislang in Leipzig weniger gespielte Werke aufs Programm, etwa Jean Sibelius und vor allem Carl Nielsen, dessen sechs Sinfonien er in Leipzig zyklisch und exemplarisch aufführte.
CD-Tipp
"Herbert Blomstedt 1998-2005", Leipziger Gewandhausorchester, querstand VKJK 0507
Hör-Tipp
Apropos Klassik, Freitag, 16. September, 23. September, 30. September 2005, 15:06 Uhr
Links
Gewandhaus Leipzig
querstand