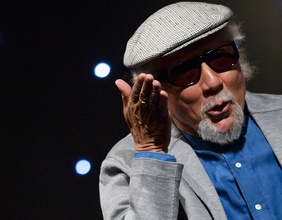Fakten, Ursachen, Gegenmaßnahmen
Hammerskins, Hooligans, Neonazis
Am 1. August wurde die traditionelle Rütli-Rede des Schweizer Bundespräsidenten von einem starken Trupp von Rechtsextremen gestört. Die Schweiz muss sich eingestehen: Der Rechtsextremismus ist zum Problem geworden.
8. April 2017, 21:58
Der Luzerner Journalist Hans Stutz zur Musikszene
Jahr für Jahr werden sie lauter in der Schweiz, die so genannten Hammerskins, Neonazis und Hooligans. Immer wieder kommen rechtsradikale Gewalttäter wie neulich in Frauenfeld in der Ostschweiz vor Gericht, weil sie im Kampf gegen Ausländer und Andersdenkende brutal zugeschlagen haben; oder sie fallen bei Demonstrationen aus der Reihe, wie erst kürzlich bei der Erst-August-Feier auf dem Rütli, wo der Schweizer Bundespräsident Samuel Schmid ausgepfiffen wurde.
Seit kurzem sind Rechtsradikale mit der PNOS, der Partei National Orientierter Schweizer, auch in der institutionellen Politik vertreten. Wie stark ist sie eigentlich, die extreme Rechte bei den Eidgenossen, und unter welchen Bedingungen zieht sie die überwiegend jungen Leute an?
Reservoire und Anzahl der Rechtsextremisten
Hauptsächlich bei Konzerten und Festen in der Skinhead-Szene werden in der Schweiz neue Mitglieder der rechtsextremen Szene rekrutiert, aber auch die gewaltbereiten Hooligans etwa in der Fußballszene sind ein Reservoir für Rechtsextremismus. Hinzu kommt das Internet als Informationskanal, um für rechtsextreme Ideen zu werben.
Die Zahl der Rechtsradikalen ist noch relativ gering, wird aber immer größer. Laut Schweizer Bundesamt geht man von etwa 1.000 Rechtsextremen aus, dazu kommen etwa 700, 800 Mitläufer oder Sympathisanten, die nicht zum harten Kern gezählt werden. Die Skinhead-Bewegung - eine ursprünglich nicht politische Jugendkultur mit ausgeprägter Musikszene wird immer mehr von rechtsextremen politischen Gruppierungen geködert. In der Schweiz gibt es drei Skinhead-Organisationen: Blood & Honour, Hammerskinheads und Morgenstern. Über ihre Musik wird rassistisches und fremdenfeindliches Gedankengut verbreitet. Ihre Konzerte verzeichneten in den letzten Jahren großen Zulauf.
Rechtsextremistische Parteien
In der Schweizer Parteienlandschaft macht sich die PNOS, die Partei National Orientierter Schweizer, am lautesten bemerkbar, obwohl sie nur etwas mehr als 100 Mitglieder hat. Ihr Parteiprogramm ist von fremdenfeindlicher, antidemokratischer und rechtsextremer Rhetorik geprägt.
Aus dem Umfeld der PNOS stammt die NAPO, die Nationale Außerparlamentarische Opposition des Holocaust-Leugners Bernard Schaub, die durch Demonstrationen und Flugblattaktionen aufgefallen ist. Dann gibt es noch die Schweizer Hammerskins oder die "Helvetische Jugend". All diese verschwindend kleinen Gruppen hätten zwar gemeinsame Ziele, seien aber nur informell und lose miteinander verbunden, sagt der Journalist und Szene-Kenner Hans Stutz.
Tobias Hirschi und Hitlers Gedankengut
Die Rechtsradikalen wollen jedenfalls immer mehr im legalen Raum Fuß fassen und versuchen, sich in die institutionelle Politik einzumischen. So gelang es im letzten Herbst dem Straßenbauer Tobias Hirschi von der PNOS, ins Langenthaler Stadtparlament zu kommen. Sein Parteiprogramm, das über weite Strecken wörtlich von Hitlers Nationalsozialisten abgeschrieben ist, musste allerdings kürzlich aus dem Internet entfernt werden. Dennoch versucht er und seine Partei immer wieder vor allem im subkulturellen Raum von Musikveranstaltungen rassistisches und antisemitisches Gedankengut zu verbreiten und zum "Rassenkrieg" gegen die Ausländer aufzurufen.
Vor allem Menschen mit schwarzer Hautfarbe werden diskriminiert, wie etwa in dem "Afrika-Lied" des Schweizer Duos "Annett und Michael". Ziel der PNOS ist "die echte Volksherrschaft anstelle einer heuchlerischen Scheindemokratie", sagt Hans Stutz. Das klingt zwar nach der Schweizerischen Volkspartei, nach der SVP von Bundesrat Christoph Blocher, dennoch lässt sich die PNOS von dieser Partei klar abgrenzen.
Aktionen immer brutaler
Der neueste Bericht über die innere Sicherheit der Schweiz hält fest, dass die Zahl der Rechtsextremen und ihrer öffentlichen Auftritte laufend zunimmt, wobei auch ihre Aktionen brutaler denn je werden. Bei den Gewalttaten geht es dabei immer öfter um die Frage, ob es sich dabei um vorsätzliche Tötungsversuche handelt. Als Beispiel wird ein Fall in Frauenfeld angegeben, bei dem sieben Rechtsextreme vor zwei Jahren zwei Jugendliche zusammengeschlagen und einer der beiden Opfer fast gestorben wäre.
Die Gewalt, die ausgeübt wird, kann sich auch gegen die eigenen Leute richten, wie der Fall von Marcel von Allmen aus Interlaken im Kanton Bern zeigt, der von seinen rechtesextremen Kameraden vor drei Jahren ermordet worden ist, weil er angeblich gegen das Schweigegelübde ihres Geheim-Ordens der "arischen Ritter" verstoßen hat.
Soziale Ursachensuche
Ein Forschungsprojekt über Jugend und Gewalt an der Universität Basel sagt aus, dass bestimmte Werthaltungen, die in der Familie hochgehalten werden, maßgebend dazu beitragen, dass Jugendliche rechtsextreme Haltungen annehmen. Zum Beispiel - so der Soziologe Ueli Mäder und der Pädagoge Wassily unisono - werde aus der Werthaltung "Nur wer etwas leistet, hat auch etwas verdient" das übersteigerte Gebot "Es darf einem nichts geschenkt werden". Vor diesem Hintergrund wird ein Asylsuchender, der einen Gutschein für's Essen oder ein Paar Franken Taschengeld bekommt, zur puren Provokation. Auch der Erziehungsstil spiele eine grosse Rolle, wobei hier der Bildungsgrad der Familie sekundär sei, meint Wassily Kassis. Der Rat: Eltern müssten einfach härter durchgreifen, wenn ihre Jugendlichen rechtsextrem und gewalttätig werden sollten.
Lange ist man laut Studie auch davon ausgegangen, dass Jugendliche deswegen rechtsextrem eingestellt sind, weil sie zu den gesellschaftlichen Verlierern gehören. Davon ist man mittlerweile abgekommen. Auch ob die Zahl der Ausländerinnen und Ausländer hoch oder tief sei, ist nicht relevant. Die Einstellungen sind vielmehr auf subjektives Empfinden zurückzuführen, das natürlich in Gruppen von Gleichgesinnten verstärkt wird.
Wirksame Gegenmaßnahmen
Die Jungfreisinnigen des Kanton Wallis kündigten kürzlich an, beim Bundesrat ein Verbot der PNOS zu beantragen. Auf der politischen Agenda steht weiter eine Verschärfung des Waffenrechts. Außerdem wird ein Gesetz über Maßnahmen gegen Rassismus, Hooliganismus und Gewaltpropaganda diskutiert.
Schliesslich werden im nächsten Jahr weitere wissenschaftliche Resultate erwartet. Ein Forschungsprogramm des Schweizerischen Nationalfonds untersucht die Ursachen und Erscheinungsformen des Rechtsextremismus und entwickelt Maßnahmen zu deren Bekämpfung.
Download-Tipp
Ö1 Club-Mitglieder können die Sendung nach Ende der Live-Ausstrahlung im Download-Bereich herunterladen.
Links
Hans Stutz - Rechtsextremismus in der Schweiz
NFP 40 + - Nationales Forschungsprogramm 40 +
Gegen Rechtsextremismus - Informationsportal