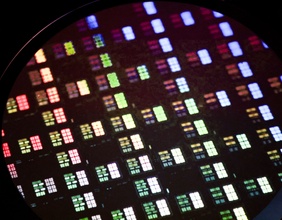Biomedizin und Alkoholsucht
Einmal süchtig - immer süchtig?
Alkoholsucht hängt eng mit den Genen für die innere Uhr zusammen. Mit modernen Bild gebenden Verfahren kann man erstmals exakt das individuelle Rückfallrisiko bestimmen. Das sind nur zwei der neuesten Erkenntnisse über Alkoholabhängigkeit und -therapie.
8. April 2017, 21:58
Bis zu 90 Prozent der Menschen in industrialisierten Ländern konsumieren alkoholische Getränke. Entsprechend hoch ist das Risiko, süchtig zu werden. Vor allem unter Jugendlichen steigt die Zahl der Alkoholkranken in den letzten Jahren enorm. Die Biomedizin versucht mit neuen Methoden, genauere Aufschlüsse über die Entstehung der Alkoholkrankheit zu finden.
Bild gebende Verfahren
Seit kurzem werden im Kampf gegen die Alkoholsucht moderne Bild gebende Verfahren genützt, mit deren Hilfe die Hirnaktivitäten sichtbar gemacht werden können. Der Psychiater und Suchtforscher Karl Mann vom Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim setzt zum Beispiel die Kernspintomographie ein, um das Rückfallrisiko von Menschen nach einem Alkoholentzug zu bestimmen.
Nützen könnten diese Erkenntnisse dazu, die Therapie ganz individuell auf den Patienten abzustimmen.
Psychotherapeutische Ansätze
Neben dem pharmakologischen Ansatz gibt es auch die Psychotherapie. Völlig neu ist hier die so genannte Expositionstherapie, eine Methode, die aus der Angsttherapie abgeleitet wurde.
Lutz Schmidt von der Psychiatrischen Universitätsklinik in Mainz arbeitet damit. Die Alkoholkranken werden mit ihren Lieblingsdrinks konfrontiert. Sie riechen daran. Das mindert die Rückfallgefahr.
Eine alte Frage ist die nach der Suchtpersönlichkeit. Nein, es gibt sie nicht, da sind sich heute alle Forscher einig. Wohl aber stellen bestimmte Persönlichkeitsmerkmale, wie die Gier nach Neuem, eine höhere Gefährdung dar, sagt der Würzburger Psychiater Jobst Boening.
Genetik und Alkoholabhängigkeit
Auch von neuen Erkenntnissen aus der Genetik erhofft man sich zielgenauere Therapien. Einer der führenden Forscher auf dem Gebiet ist der gebürtige Chinese Ting Kai Li. Er ist Direktor des National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism, einer Abteilung der National Institutes of Health in den USA.
Ting Kai Li forscht an genetischen Unterschieden, die bei Alkoholismus eine wichtige Rolle spielen. Viele Asiaten - Chinesen, Koreaner und Japaner- tragen zum Beispiel eine Genvariante, durch die Alkohol völlig anders verstoffwechselt wird als bei Europäern. Dadurch vertragen sie weit weniger. Viel zu wenig erforscht sei auch das Zusammenspiel zwischen Umwelt und Genen, sagt Ting Kai Li
An Genvarianten, die mit der Alkoholsucht zu tun haben, forscht auch der Psycho-Pharmakologe Rainer Spanagel vom Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim. Eines ist aus seinen Arbeiten völlig klar geworden: Alkoholsucht und die Gene für unsere innere Uhr - die beiden haben viel miteinander zu tun - in beide Richtungen.
Eine verstellte innere Uhr, wie sie sich etwa im Jetlag durch Reisen über Zeitzonen äußert, fördert zum Beispiel die Alkoholsucht. Flugpersonal ist daher sehr suchtgefährdet.
Ab wann besteht Suchtgefahr?
Wo sind die Grenzen zwischen moderatem Alkoholkonsum und riskantem Trinken? Maximal zwei Flaschen Bier oder ein halber Liter Wein pro Tag. Das sind circa 30 g Alkohol. Wer mehr konsumiert, gehört zu den Suchtgefährdeten oder bereits Süchtigen. Für Frauen liegt die empfohlene Obergrenze tiefer, bei 20 g Alkohol.
Download-Tipp
Ö1 Club-Mitglieder können die Sendung nach Ende der Live-Ausstrahlung im Download-Bereich herunterladen