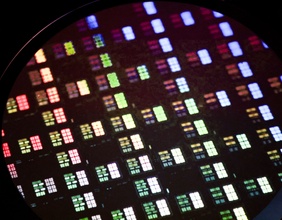Die Angst vor dem Orient
Anthrax
Es war einmal ein Präsident. Der war ziemlich amtsmüde und auch mit seiner Geliebten hatte er schon bessere Zeiten erlebt. So beginnt die Geschichte, die Philipp Sarasin erzählt und damit das Märchen vom Bioterror auf seinen mythologischen Gehalt hin untersucht.
8. April 2017, 21:58
Besagter Präsident tat, was andere einsame Menschen zuweilen auch tun und griff des nächtens ins Buchregal. Als seine Gedanken im Oval Office um Richard Prestons Science-Fiction-Roman "The Cobra Event" kreisten, hätte der Präsident gerne mit jemandem darüber gesprochen, weil das, was er da zu lesen bekam, schwerlich alleine auszuhalten war:
Die 17-jährige Kate Moran infiziert sich in der New Yorker U-Bahn mit einem Virus, das ihr Nervensystem zersetzt. Ein hartgesottener Leser hätte den Plot gerade mal verdaut, aber für einen ohnehin angeschlagenen Präsidenten waren die detail- und blutreichen Schilderungen von Kate Morans tödlichem Zerfall dann doch etwas zu viel.
Plausch mit Profis
Weil so gar niemand mit dem Präsidenten über das Buch sprechen wollte, lud dieser kurzerhand die hochrangigsten Experten für Genetik, Biowaffen und Gesundheitswesen zu sich, um mit diesen einen Lesezirkel über Prestons Horrorszenario abzuhalten. Denen ist das zwar ein wenig peinlich, aber die Chance auf ein Privatissimum mit dem Präsidenten lässt man nicht einfach sausen. Alsbald lässt der Präsident ein milliardenschweres Maßnahmenpaket zur Abwehr von Bioterror-Attacken beschließen.
Die politischen Auswirkungen von Clintons Lektüre waren erkennbar - und sie waren erheblich. Der Präsident sprach seit dem Beginn des Jahres 1998 in all seinen Reden von Bioterrorismus, den er als die Kehrseite der Globalisierung bezeichnete, und zwar in einer Art, die seine Umgebung und seine Berater als obsessiv empfanden.
Dem Bösen den Garaus machen
Ein paar Jahre später bezog ein neuer Präsident das Weiße Haus. Der hatte zunächst andere Obsessionen und für die Kehrseite der Globalisierung schon gar nichts übrig. Das sollte sich mit dem 11. September 2001 ändern. Von nun an musste auch der neue Präsident zur Kenntnis nehmen, dass es rund um sein Land noch eine Menge Welt gab, die mitunter komplizierter war, als er sich das in der texanischen Prärie vorgestellt hatte.
Als obendrein kurz darauf im ganzen Land Briefe mit falschen und echten Anthrax-Sporen verschickt wurden, besann sich der neue Präsident wider Erwarten der Prioritätenliste seines Vorgängers und beschwor das Gespenst vom drohenden Bioterror aufs Neue herauf. Nicht zuletzt, um einem anderen Präsidenten, der in einem fernen, arabischen Land sein Unwesen trieb - und mit dem es ohnehin noch ein paar offene Rechnungen zu begleichen galt - endgültig den Garaus zu machen.
Die kleine Prise Anthrax hat ein Narrativ wahr gemacht, das seit der zweiten Hälfte der 1990er Jahre immer wieder und immer häufiger verwendet wurde. Doch warum hat man dieser Bioterror-Geschichte so gerne zugehört? (...) Es gibt nur einen Grund: Weil diese Geschichte einen phantasmatischen Kern hat, weil, mit anderen Worten, die Bioterrorgeschichte einem dichten Vorstellungskomplex mit großer historischer Tiefe und damit einer bestimmten Vorurteilsstruktur im vornehmlich westlichen Imaginären entspricht.
Die neue Qualität der Politik
Wie tief die kollektive Verankerung dieser Vorurteilsstruktur ist, das belegt der Historiker Philippe Sarasin anhand zahlreicher Exkurse in die Sozialgeschichte. Sarasin zeigt eindringlich auf, dass es in den westlichen Gesellschaften einen engen Zusammenhang zwischen Infektionsparanoia und fremdenfeindlich motivierten Exzessen gibt und dass die bevorzugte Projektionsfläche dieser unglückseligen Angstabwehr von jeher der Orient gewesen ist. Die neue Qualität dieser biologisierten Politik sieht der Autor in der Gleichschaltung von Terror und Bioterror.
Es ist wenig überraschend, dass der Sozialwissenschaftler Sarasin in seiner Analyse von Foucault abwärts alle Großmeister des Strukturalismus bemüht, und es ist bezeichnend, dass er Jacques Lacan ins Treffen führt, der wohl als erster der modernen, kulturwissenschaftlichen Betrachtung von politischen Phänomenen zu einer psychoanalytischen Tiefenschärfe verholfen hat. Gegen den einschlägigen Jargon ist im Grunde nichts einzuwenden, wohl aber gegen Sarasins Vermengung dieser Terminologie mit zeitweise recht launigen Kommentaren. Innerhalb eines theoretischen Bezugssystems, bei dem es zentral auf den Unterschied zwischen Phantasma und Phantasie, zwischen Signifikat und Signifikant ankommt, funktioniert die bemühte Lässigkeit des Akademikers nicht. Viele der Zusammenhänge, die Sarasin herstellt, sind schlüssig und plausibel, einige davon haben uns beispielsweise Jean Baudrillard und Slavoj Zizek präziser erzählt, und wer es ohnehin geschwätziger mag, der ist bei Larry King dann doch besser aufgehoben.
Buch-Tipp
Philippe Sarasin, "Anthrax", edition suhrkamp Nr. 2368