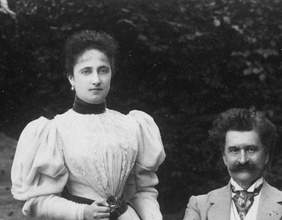Zwischen Philosophie und Neurobiologie
Ist der Mensch ein freies Wesen?
Je differenzierter die Einzelwissenschaften werden, desto detaillierter das Wissen über den Menschen. Je mehr die Wissenschaften die Bedingungen menschlichen Handelns erforschen, desto mehr scheint der freie Wille des Menschen relativierbar.
8. April 2017, 21:58
Der Soziolge Manfred Prisching über die unbeschränkte Freiheit
Immer häufiger treten Neurobiologen, Psychologen, Sozialwissenschaftler und auch Philosophen auf die Bühne, die den freien Willen und die Annahme eines Ich-Zentrums innerhalb der menschlichen Erkenntnis in Frage stellen. Sie folgern weiter, dass Freiheit, Autonomie und Verantwortung - zwar sozial unabdingbar und erwünscht, aber letztlich dennoch Illusionen sind.
Nur die Abfolge neuronaler Prozesse?
Allen voran die Gehirnforschung und die Neurobiologie beschreibt menschliches Verhalten als Abfolge neuronaler Prozesse, die sich im Gehirn abspielen und mit naturwissenschaftlichen Methoden beschrieben, rekonstruiert und prognostiziert werden.
Freiheit und Autonomie bestünde maximal in der nachträglichen Zustimmung des Menschen zu fix vorgebahnten neuronalen Gehirnmustern. Solche sich auf empirische Forschungen berufende Thesen sind nicht nur ein massiver Angriff auf das bisherige Menschenbild, sondern implizieren auch eine grundsätzliche Infragestellung des zukünftigen Sinns jeglicher Geisteswissenschaft.
Aus der Sicht der Psychobiologie
Unbestritten ist in der gegenwärtigen Forschung, dass unserem Denken, Erleben und Verhalten eine Vielzahl gut untersuchter biologischer Faktoren zu Grunde liegt. Die Zusammenhänge zwischen Hirnfunktion und Intelligenz einerseits sowie Emotionen andererseits sind gut dokumentiert.
Beispielsweise hat die Komplexität der Vernetzung zwischen Neuronen einen wichtigen Einfluss auf die kognitive Leistung und auch auf die Gehirngröße. Emotionen beispielsweise können aber auch die Entscheidungsfreiheit stark beeinträchtigen.
Der freie Wille und die Neurobiologie
Die moderne Hirnforschung beschreibt menschliches Verhalten als Abfolge neuronaler Prozesse. Diese Verschaltungsvorgänge werden als die maßgeblichen Determinanten für menschliche Freiheit angesehen.
"Die Annahme, wir seien vollverantwortlich für das, was wir tun, das heißt unser freier Wille, ist aus neurobiologischer Sicht nicht mehr haltbar." Diese vieldiskutierte These vertritt der renommierte Frankfurter Neurobiologe Wolf Singer, der das Max-Planck-Institut für Hirnforschung in Frankfurt leitet.
"Mein Argument geht dahin, dass die Unterscheidung in freie und unfreie Handlungen aus neurobiologischer Sicht wenig plausibel ist, denn in beiden Fällen sind neuronale Abläufe zuständig, einmal bewusst andernfalls unbewusst, die deterministischen Gesetzen gehorchen. Deshalb ist diese Unterteilung, die wir kulturgeschichtlich gemacht haben, in freie und strafbare Handlungen und unfreie Handlungen nicht tragfähig", erklärt Singer.
Gesellschaftliche Folgen
Dies hätte aber schwerwiegende Auswirkungen auf unser Menschenbild, unsere Kultur, die Grundlagen unseres Zusammenlebens. Wenn dem so wäre, könnte man beispielsweise sagen: Ich konnte nicht anders, ich musste meinen Gegner erschlagen. Das hieße aber auch, unser ganzes Rechtssystem stünde letztlich - weil von falschen Voraussetzungen ausgehend - vor einer Legitimationskrise.
Philosophische Aspekte
Auch die Philosophen, die behaupten, dass Freiheit und Determinismus nicht vereinbar ist, glauben, dass das Gehirn ein System von Neuronen ist, das nur durch den Input von außen gesteuert wird. Sie nehmen an, dass zwischen den determinierenden Ursachen und mir selbst als handelnder Person ein Konkurrenzverhältnis besteht. Und sie argumentieren: Wenn meine Entscheidungen determiniert sind, dann handle ich nicht frei.
Nun besteht aber eine schwer zu überbrückende Diskrepanz darin, dass wir uns selber nicht als neuronale Verschaltungsmuster, sondern als frei agierende Wesen erfahren. Müsste dies - unabhängig von dem realen Wirken neuronaler Vorgänge - Auswirkungen auf das Urteil über Willensfreiheit und Verantwortung haben? Sind wir es, die entscheiden, oder folgen wir unbewusst neuronalen Verschaltungsmustern - das ist die entscheidende Frage.