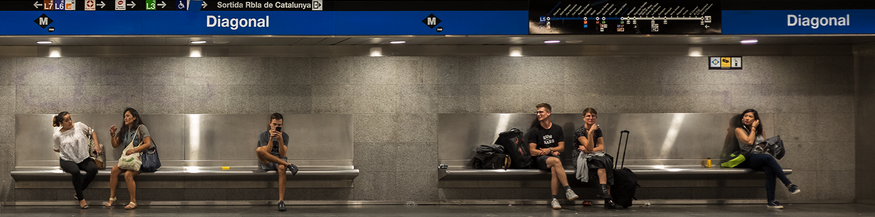Über Wüstenväter und andere Mystiker
Kleine Theologie der Kirchenväter
Das Wort "Kirchenväter" klingt ein wenig nach gipsernen Heiligenstatuen und nach altmodischen Kirchenmännern. Die Theologen der ersten christlichen Jahrhunderte wurden zwar im Laufe der Zeit zu Gipsstatuen, doch tatsächlich waren sie höchst lebendige Denker.
8. April 2017, 21:58
Hans Peter Sturm zur inneren Ruhe der Hesychasten:
Erst in den letzten Jahrzehnten werden sie wiederentdeckt - die Kirchenväter - und zur Überraschung vieler stellt sich dann heraus, dass zwischen einem Gregor von Nyssa, der im vierten Jahrhundert nach Christus lebte, und einem indischen Yogi kein so großer Unterschied ist. Die beiden könnten sich gut miteinander über ihre spirituelle Praxis unterhalten. Ein moderner Theologe hätte es da schon etwas schwerer - es sei denn, er hätte auch Yoga geübt oder Zen oder sonst eine der asiatischen Meditationsformen.
Die Wüstenväter
Die sogenannten Wüstenväter sind die Keimzelle christlicher Mystik. Im Römischen Reich hatte damals das Christentum gerade seinen Status als verfolgte Kirche verloren und begann sich zu etablieren. Katharina Ceming, Professorin für Systematische Theologie in Paderborn, zur damaligen Zeit:
"Gar nicht so wenige Frauen und Männer gingen damals in die Wüste - im wörtlichen Sinn, denn sie wollten Gott schmecken und spüren. Deswegen nahmen sie ein Leben in Entbehrung auf sich. Ähnlich wie Yogis oder buddhistische Mönche verfolgten sie einen spirituellen Übungsweg."
Die Ruhe des Herzens
"Wer Gott schaut, findet die Ruhe des Herzens" - danach suchten die Wüstenväter. Johannes Cassian z. B. schreibt:
"Das ganze Streben des Mönches und die Vollkommenheit des Herzens zielt auf die beständige und ununterbrochene Beharrlichkeit im Gebet und richtet sich auf eine unbewegliche Ruhe des Geistes und immerwährende Reinheit."
Diese sogenannte "Ruhe des Herzens" ist auch das Ziel des Jesusgebets der Hesychasten. Hans Peter Sturm - Philosoph an der Universität Augsburg - meint dazu:
"Diese Ruhe, nach der die spirituellen Praktiker des Christentums suchen, ist keine tote, sondern eine sehr lebendige Ruhe, eine Windstille der Gefühle sozusagen. Darum geht es auch buddhistischen Mönchen, wenn sie nach dem Nirvana suchen."
Kirchenvater Clemens
Wenn man will, kann man die hebräische Bibel als eine Art Anweisung lesen, wie man Gott erfahren kann. Für den Kirchenvater Clemens, der im zweiten Jahrhundert nach Christus in der großen antiken Hafenstadt Alexandrien im heutigen Ägypten lebte, war der Zusammenhang von Selbsterkenntnis, Gotteserkenntnis und gutem Leben ganz selbstverständlich. Er schreibt:
"In der Pflege der menschlichen Beziehungen geht es um Besserung oder um Dienstleistung. So ist es der Beruf des Arztes, den Leib, und der Beruf des Philosophen, die Seele besser zu machen. Ein Gottesfreund ist gewiss der, der weiß, was in Erkenntnis und Leben richtig und angemessen ist: wie jemand zu leben hat, der einmal vergottet sein wird und jetzt schon gottähnlich."
Ein moderner Christ stolpert wahrscheinlich über den letzten Satz. Denn dass ein Mensch vergottet werden kann oder gottähnlich, davon spricht man in der Theologie der Neuzeit nicht mehr.
Der Heilige Augustinus
"Gott ist Mensch geworden, damit der Mensch Gott werde" - steht beim Heiligen Augustinus, der dreihundert Jahre nach Clemens lebte. Diesen Satz kann man heute auch vom Heiligen Vater, Papst Johannes Paul, dem Zweiten, hören. Dahinter steckt eine ganz andere Philosophie, nämlich die antike griechische Philosophie. Die antiken philosophischen Schulen ähnelten eher den spirituellen Schulen Asiens, den Ashrams in Indien oder buddhistischen Klöstern in Thailand. Das ist erst in den letzten Jahrzehnten deutlich geworden. In dieser Philosophie liegen aber die Wurzeln des christlichen Abendlandes. Philosophen wie Platon, Aristoteles oder den stoischen und epikuräischen Denkern ging es vor allem um die Frage nach dem guten Leben.
"Ich zweifle, also bin ich"
Was vielen heutigen Menschen das Christentum suspekt macht, ist, dass man anscheinend nicht zweifeln darf, sondern glauben muss. Das Christentum ist eine Religion des Glaubens, heißt es meistens. Und man sagt auch, der erste, der sich im christlichen Abendland an allem zu zweifeln traute, sei der Philosoph Descartes gewesen, der im 16. Jahrhundert lebte. Aber das stimmt nicht. Einer der wichtigsten Befürworter des Zweifels war z. B. der Kirchenvater Augustinus, rund tausend Jahre früher. Von Augustinus stammt auch der Satz: "Ich zweifle, also bin ich!" Für ihn ist der radikale Zweifel die Voraussetzung für die Erkenntnis Gottes.
Der Kirchenlehrer Thomas von Aquin
Man betont heute in der Theologie sehr oft, dass es im Christentum einen persönlichen Gott gibt, ein Gegenüber. Doch die Kirchenväter kennen auch ein ganz anderes Bild oder besser Nicht-Bild von Gott, eine apersonale Gottesvorstellung, die ihre biblischen Wurzeln im Bilderverbot hat. Wer in diesen Bereich des Nicht-Bildes, der Unbegreiflichkeit Gottes eintreten will, muss alles hinter sich lassen, und vor allem sich selbst.
Der große Kirchenlehrer des Mittelalters, Thomas von Aquin, schreibt:
"Nur der kann es empfangen, der sprechen kann: Todesbangen hat gewählt meine Seele und Sterben mein Gebein. Wer diesen Tod liebt, der mag Gott schauen, denn unbezweifelbar ist es wahr, dass niemand Gott schauen kann und leben. So lasst uns denn sterben und eintreten in die Finsternis."
Links
Kirchenväter - Informationen im ökumenischen Heiligenlexikon
Kirchenväter-Kommission
Mehr zu Religionssendungen in Österreich 1 in religion.ORF.at