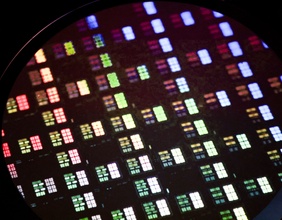Geschichte als Rührstück?
Rosenstraße
Eine Geschichte weiblicher Zivilcourage im Dritten Reich erzählt die deutsche Regisseurin Margarethe von Trotta in ihrem neuesten Film.
8. April 2017, 21:58
"Wir wollen unsere Männer zurück! Wir wollen unsere Männer zurück!". Plötzlich bricht es aus den Frauen, die vor einem Sammellager der Nazis in der Berliner Rosenstraße offen heraus. Drinnen vegetieren ihre jüdischen Ehemänner dahin, warten auf ihr weiteres Schicksal.
Zusammengepfercht auf wenigen Quadratmetern und voller Ungewissheit. Draußen warten ihre nichtjüdischen Ehefrauen. Immer ungeduldiger und immer entschlossener, die Willkür der Nazis nicht einfach hinzunehmen. Bis es zu den offenen Protesten kommt. Man schreibt das Jahr 1943. Einmal mehr Geschichte als "wahre Geschichte" im Kino.
Fiktive Erzählmuster
Das bislang weitgehend unbekannte Kapitel deutscher Historie rund um die Ereignisse in der "Rosenstraße" hat Regisseurin Margarethe von Trotta nunmehr für das Kino bearbeitet. Dabei verpackt von Trotta historische Fakten in fiktive Erzählmuster, greift das Einzelschicksal der (fiktiven) Pianistin Lena Fischer (Katja Riemann) heraus, um daraus das kollektive Drama zu entwickeln: Eines Tages kehrt der Jude Fabian Fischer (Martin Feifel) nicht mehr von seiner Arbeit zurück.
Unnötige Rahmenhandlung
Bereits 1994 hatte Margarethe von Trotta ein Drehbuch zu dieser Geschichte geschrieben, das damals allerdings von diversen Fördergebern abgelehnt wurde. Daher hat sie in der nun mehr verfilmten Version eine zusätzliche Rahmenhandlung entworfen, in der Hannah (Maria Schrader), die Tochter einer nach New York Geflüchteten Jüdin aus heutiger Sicht den Ereignissen von damals auf den Grund geht.
Doch gerade diese Rahmenhandlung erweist sich als umständliche Konstruktion, die manchmal den Blick auf die Kerngeschichte verstellt. Als würde nicht die in der Vergangenheit angesiedelte Geschichte genug Dramatik bieten, wird der Zuseher auch noch mit Hannahs Beziehungsproblemen konfrontiert, nicht zuletzt, um auch hier zu einem (zweiten) "Happy End" zu kommen.
Positiv wurde Margarethe von Trottas Film die ästhetische - an klassisches Kino angelehnte- Zurückhaltung angerechnet. Ein formales Anbiedern an die Lässigkeiten, mit der deutsches Kino - siehe die Christopher Roths Baader-Film - der Geschichte bisweilen gegenübersteht, ist der Regisseurin fremd.
Doch auch mit negativer Kritik wurde nicht gespart, "Warme Blicke auf die Nazizeit" titelte etwa die Berliner "taz" und der Historiker Wolfgang Benz, Leiter des Berliner Instituts für Antisemitismusforschung, sprach in der Süddeutschen Zeitung von "Kitsch" und einer "Klamotte, der er die historische Wirklichkeit opfert".
Schließlich wirft Benz Trotta vor "die Geschichte zum Rührstück verkommen lassen." "Rosenstraße" wirft also einmal mehr das Dilemma auf, wie sehr man zugunsten von Breitenwirksamkeit im Spielfilm den Anspruch auf historische Authentizität aufweichen kann und darf.
Rosenstraße
Deutschland, 2003
mit: Katja Riemann, Maria Schrader, Martin Feifel, Jürgen Vogel, Martin Wuttke
Drehbuch und Regie: Margarethe von Trotta