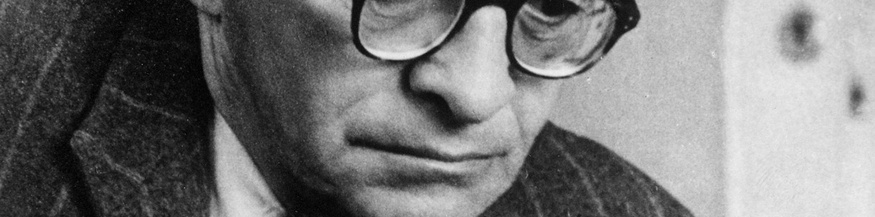Zum 30. Todestag der Kultprimadonna
Callas und kein Ende
Am Sonntag jährt sich zum 30. Mal der Todestag von Maria Callas, dieser Kultprimadonna, die wie keine zweite noch immer alle Aufmerksamkeit auf sich zieht. Auch dieser Todestag wird Spuren hinterlassen: Mit neu veröffentlichten Büchern, CDs und DVDs.
8. April 2017, 21:58
Gebet der Tosca aus Puccinis "Tosca"
Eigentlich, so würde man meinen, sollte zum Thema Callas schon alles gesagt sein. Es gibt meterweise Literatur über sie, jedes winzigste Tondokument von ihr wurde schon x-fach ausgeschlachtet und Neuentdeckungen sind kaum mehr zu erwarten, schon gar nicht Mitschnitte ihrer legendären Wagner-Auftritte als Brünnhilde und Isolde am Beginn ihrer Laufbahn.
Dennoch beschert auch ihr 30. Todestag dem dahinkränkelnden Klassik-Markt neue Impulse: eine Gesamtausgabe aller ihrer Studioaufnahmen (70 CDs!), diesmal wirklich von den EMI-Originalbändern, daneben eine unüberschaubare Menge von CDs in Zweit-, Dritt- und Viertvermarktungen und in oft abenteuerlichen Zusammenstellungen. Dazu - angeblich neu überarbeitet - DVDs ihrer spärlichen Filmdokumente, am Buchsektor sind riesige Bildbände mit teilweise obskuren Schnappschüssen erschienen, ein Kochbuch (!) mit von ihr gesammelten Rezepten.
Der Name Callas verkauft sich offenbar immer noch sehr gut, ja vielleicht sogar besser und gewinnträchtiger (weil tantiemenfrei) als zu ihren Lebzeiten.
Im Zentrum der Aufmerksamkeit
Als 1985 der renommierte amerikanische Musikpublizist Andrew Farkas eine internationale Bibliographie über Opern- und Konzertsänger veröffentlichte, brachte es Maria Callas - damals acht Jahre tot - bereits auf nicht weniger als 38 Einträge. Zum Vergleich: Ihre vielleicht berühmtesten Nachfolgerinnen Joan Sutherland (Jahrgang 1926) und Montserrat Caballe - zehn Jahre jünger als die Callas - schafften zu diesem Zeitpunkt gerade drei beziehungsweise nur einen einzigen Eintrag!
Waren die beiden also wirklich so viel schlechtere oder uninteressantere Künstlerinnen als die griechisch-stämmige New Yorkerin? Oder haben sie einfach nur weniger publicity-wirksame Aufregungen provoziert als die oft als "Skandal-Primadonna" titulierte Callas?
Zum Gesamtkunstwerk hochstilisiert
Fragen, die weit vielschichtiger sind, als dass man sie einfach mit ja oder nein beantworten könnte, denn Maria Callas war beziehungsweise ist eigentlich erst nach ihrem Tod zu einem Gesamtkunstwerk hochstilisiert worden, das sich längst jeder objektiven Beurteilung entzieht. Wer hat sich da alles über sie ausgelassen, ganz abgesehen von so seriösen Biographen wie zum Beispiel John Ardoin, Jürgen Kesting oder Henry Wisneski?
Da gibt es Bücher über sie von ihrer Mutter, ihrem Ehemann Meneghini, der Ehefrau ihres Langzeitpartners di Stefano ("Callas Nemica Mia"), aber auch von Schmuddel-Journalisten, die sie schon aufgrund ihrer späten Geburt niemals mehr auf der Bühne oder auch nur im Konzertsaal erleben konnten, dafür aber bedeutungsschwangere Interviews mit ehemaligen Zimmermädchen oder Hotelportieren führen, um den selbst ein Vierteljahrhundert nach ihrem Tod offenbar noch nicht erloschenen Voyeurismus gewisser "Adabeis" auch heute noch zu befriedigen.
Angeblicher Mundgeruch des Tenorpartners
Anders wäre es ja nicht möglich, dass nach wie vor immer noch neue Bücher und Internet-Seiten über sie erscheinen, und sei es auch nur, um über irgendwelche (Schrei-)Duelle zwischen Onassis und ihrem Ehemann zu referieren oder über den angeblichen Mundgeruch eines ihrer Tenorpartner.
Ebenso unerträglich scheinen auch die ständig wiedergekäuten Legenden über ihre (angeblichen) Bühnen-Skandale. Bei näherer Betrachtung findet man nämlich nur einen einzigen Vorfall in ihrer Karriere, der (vielleicht) diese Bezeichnung verdient, nämlich die berühmte römische Norma von 1958, bei der sie nach Ende des 1. Aktes aus physischen Gründen nicht mehr weitersingen konnte.
Skandal nicht Callas zuzuschreiben
Dass der Abbruch dieser Vorstellung den anwesenden italienischen Staatspräsidenten eventuell brüskiert hat, kann ja möglich sein, doch wenn dabei von einem Skandal die Rede ist, so ist dieser keinesfalls Maria Callas zuzuschreiben, sondern einfach dem unprofessionellen Management des Opernhauses, das eben rechtzeitig für eine geeignete Cover-Besetzung hätte sorgen müssen.
Trotzdem: Maria Callas einen Skandal anzuhängen, war immer weit interessanter, als dies bei irgendwelchen anderen ihrer Kolleginnen zu tun, denn hier konnte man sich in der Tat mit einer echten "Tigerin" anlegen, und das befriedigt eben auch die Abenteuerlust, weit mehr als charmante Plaudereien über eine noch so bedeutende Operndiva.
Herausragende Gesangskünstlerin
Aber betrachten wir einmal ausschließlich ihre Stellung als eine der herausragenden Gesangskünstlerinnen des 20. Jahrhunderts. Auch da scheint heute vieles auf geradezu groteske Art und Weise verzerrt und übertrieben. Weder war sie die erste große Singschauspielerin, noch hat sie die Belcantooper vor der Vergessenheit errettet und auch die Breite ihres Repertoires war nicht so viel ungewöhnlicher als die Rollenvielfalt anderer ihrer Zeitgenossinnen oder Vorgängerinnen..
Was sie wirklich von den meisten anderen Opernkünstlern abgehoben hat, aber war die sozusagen "geringe Dosierung", in der all das stattgefunden hat. Heute noch ein Geheimtipp, war sie morgen schon die umjubelte "Primadonna assoluta" - die nicht zuletzt auch wesentlich zur Verbreitung der Langspielplatte beigetragen hat -, und übermorgen bereits ein Phantom, von dem zwar alle Welt sprach, das man jedoch nur allzu bald vergeblich auf den Opernbühnen suchte, obwohl sie gerade erst einmal 40 geworden war.
Zwiegesänge mit Pudel
Da musste und muss bis heute jeder Ton herhalten, den sie irgendwann einmal irgendwo gesungen hat, ganz egal, ob er gelungen war oder nicht, ob sich legal oder illegal davon ein Mitschnitt erhalten hat, wie primitiv die jeweilige Aufnahmetechnik auch gewesen sein mag, alles wurde und wird ausgewertet, bis zu privaten Zwiegesängen mit ihrem Pudel.
Zuerst waren es wohl die wirklichen, ehrlichen Enthusiasten, die quasi in "Robin-Hood-Manier" alle Welt mit ihren Callas-Schätzen begeistern wollten, heute sind längst unzählige Geschäftemacher in diesem Metier tätig, deren Anzahl mit jedem Tag ansteigt, an dem nach Ablauf der Urheberrechtsfristen jetzt auch ihre Studioeinspielungen nach und nach frei werden.
Ein Sonderfall der Operngeschichte
So bleibt Maria Callas also auch drei Jahrzehnte nach ihrem Tod ein absoluter Sonderfall der Operngeschichte, deren wahre Größe sich all jenen, die sie persönlich nicht mehr erleben konnten, aber nur dann erschließen kann, wenn sie bereit sind, die Callas für sich selbst immer wieder neu zu entdecken.
Zu entdecken mit zumindest einer Spur von jenem Perfektionismus, der die Grundlage ihrer Künstlerpersönlichkeit gewesen ist, und der damit auch größtmögliche kritische Distanz einfordert zu allen schriftlichen, akustischen und visuellen Dokumenten, Kommentaren und Analysen, mit denen wir laufend zum Thema Callas überflutet werden.
Hör-Tipp
Apropos Oper, Dienstag, 18. September 2007, 15:06 Uhr