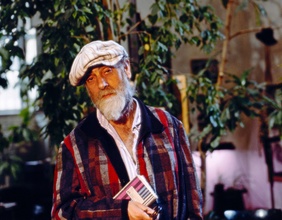Haydn und die Kaiserhymne
Hymnen und Lobgesänge
Die Basis für christliche Hymnen bilden, neben Quellen aus dem Alten Testament, auch griechische Lobgesänge. Diese sang man zur Ehren der Götter, aber auch bei Hochzeiten. Für die Christenheit adaptiert wurden diese Hymnen von Bischof Ambrosius.
8. April 2017, 21:58
Verwandt mit den religiösen Hymnen sind diverse Lobgesänge an weltliche Herrscher. Mit dem Aufkommen der Nationalstaaten bekam die Hymne eine andere Konnotation. Fortan sollten Hymnen die Menschen auf eine gemeinsame Geschichte und gemeinsame Werte einschwören und das meist in Abgrenzung zu Anderen.
Löst ein Stück bei vielen Menschen positive Emotionen aus, dann kann das die Basis dafür sein, dass aus einem Werk eine Hymne entsteht. Wobei dieses Kriterium auf viele verschiedene Musikrichtungen zutrifft.
Persönliche Hymnen
Der Bogen spannt sich von modernen Hymnen der Popmusik über christliche Lobgesänge bis zu jenen Hymnen, die dazu beitrugen - und nach wie vor beitragen -, die Identität von Staaten und Herrschaftssystemen zu festigen.
Ein Beispiel für diesen Zweck waren die alten österreichischen Kaiserhymnen. Der Plural deshalb, weil es zwar nur eine einzige Melodie gab, dazu aber immer wieder neue Texte, denn die Hymnen waren dem jeweiligen Herrscher persönlich gewidmet.
Komponiert wurde die Melodie zu den Kaiserhymnen von Joseph Haydn rund um den Jahreswechsel 1796/97.
Haydns Vorbild
Als musikalisches Vorbild diente Haydn die englische Hymne, die sich ebenfalls nicht auf einen Staat, sondern auf einen Herrscher bezieht und, je nachdem, "God Save the Queen" beziehungsweise "God save the King" heißt.
Als Hymne eingeführt wurde die Haydn-Melodie als Reaktion auf die Niederlagen Österreichs gegen Napoleon im Jahr 1797. Damit war das Römisch-Deutsche Kaisertum, dem der österreichische Kaiser damals vorstand, in seiner Legitimität bedroht - bedroht durch das Gegenmodell des republikanischen Frankreich.
Alle Sprachen gleichzeitig
Durch das Etablieren der österreichischen Kaiserhymnen (oder Volkshymnen, wie sie auch genannt wurden) sollte, so die Idee, die Bande zwischen dem Kaiser und seinen Völkern gestärkt werden. Der jeweilige Text wurde deshalb in alle Sprachen der Monarchie übersetzt.
Als deren Ende absehbar war, sollte die Hymne noch einmal den brüchig gewordenen Zusammenhalt der Völker beschwören. Im Ersten Weltkrieg, am 29. September 1915, wurden die Volkshymnen in allen Sprachen Österreich-Ungarns, und zwar gleichzeitig, gesungen.
Eine Hymne macht Karriere
Zur Melodie von Joseph Haydns Kaiserhymne schrieb im Jahr 1841 August Heinrich Hoffmann von Fallersleben das Deutschlandlied. Mehr als 80 Jahre später, im Jahr 1922, wurde diese in der Weimarer Republik zur offiziellen Hymne des Deutschen Reiches erklärt. Eine Hymne mit insgesamt drei Strophen.
Gleich in der ersten Strophe wurden die so niemals vorhandenen Grenzen eines großdeutschen Staats idealtypisch festgelegt. Sie lautet:
Deutschland, Deutschland über alles,
über alles in der Welt,
wenn es stets zu Schutz und Trutze
brüderlich zusammenhält,
von der Mars bis an die Memel,
von der Etsch bis an den Belt -
Deutschland, Deutschland über alles, über alles in der Welt.
Einigkeit, Recht und Freiheit
Nach dem Zweiten Weltkrieg konnte dieser imperiale Anspruch, der sich aus dem Text der Hymne ableitet, nicht mehr weiter aufrecht erhalten werden. Aus diesem Grund wird heute als offizielle Hymne der Bundesrepublik Deutschland nur noch die Dritte Strophe des Deutschlandliedes gesungen. Diese bezieht sich auf Einigkeit, Recht und Freiheit.
Dass die Gebiete, die in den Texten von Hymnen besungen werden, nicht mit den tatsächlichen Grenzen eines Landes übereinstimmen, ist nicht nur auf die ursprüngliche Fassung des Deutschlandliedes beschränkt. Auch in österreichischen Landeshymnen werden noch Grenzen und Territorien beschrieben, die es so längst nicht mehr gibt.
Zum Beispiel in der ersten Strophe der Tiroler Landeshymne "Zu Mantua in Banden". Da heißt es:
Zu Mantua in Banden
der treue Hofer war.
In Mantua zum Tode
führt ihn der Feinde Schar;
Es blutete der Brüder Herz,
ganz Deutschland, ach in Schmach und Schmerz!
Mit ihm das Land Tirol.
Hymne thematisiert Untersteiermark
Eine weitere österreichische Landeshymne in der noch ein alter Grenzverlauf besungen wird, ist die steirische, in der nach wie vor die Untersteiermark thematisiert wird.
Die Hymnen der österreichischen Bundesländer kann man als Ausdruck einer föderalistischen Staatsidee interpretieren. die österreichische Bundeshymne der Zweiten Republik als Neuanfang eines Staates, dessen Kennmelodie nach 1945 nicht mehr akzeptabel schien.
Haydn-Hymne geschichtlich belastet
Begründet wurde dies durch den damalige Unterrichtsminister Felix Hurdes, der meinte:
Zweifellos würde jeder Österreicher die alte Haydn-Hymne mit einem zeitgemäßen Text schon mit Rücksicht darauf, dass es sich hier um altes österreichisches Kulturgut handelt, für die gegebene österreichische Hymne halten. Leider hatte sich aber das Deutsche Reich dieser Melodie bemächtigt und für die unterdrückten Völker Europas war diese Melodie während der Jahre ihres Leidens als Hymne der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft so verhasst geworden, dass jedes Abspielen der Haydn-Melodie im Ausland als Provokation empfunden würde.
Die Melodie der heute gültigen österreichischen Bundeshymne, wird - wissenschaftlich ist dies allerdings nicht zu beweisen - Wolfgang Amadeus Mozart zugeschrieben. Der Text stammt von Paula von Preradovic.
Hör-Tipp
Radiokolleg, Montag, 22. Oktober bis Donnerstag, 25. Oktober 2007, 9:45 Uhr
Links
Bundeskanlzeramt - Österreichische Bundeshymne
Land Steiermark - Hymnen der österreichischen Bundesländer
Deutsches Bundesministerium des Innern - Text, Noten und Audiodatei der deutschen Nationalhymne