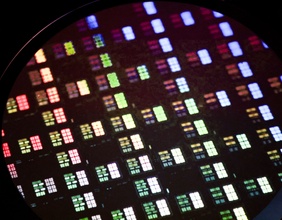Geschichten vom alter Ego
Hemingway und die toten Vögel
Boris Saidmans Debütroman "Hemingway und die toten Vögel" ist ein autobiografisches Buch, denn was seinem Protagonisten Tolik passiert, hat auch sein Alter Ego erlebt, der heute in Israel lebende Autor, der aus der ehemaligen Sowjetunion stammt.
8. April 2017, 21:58
Ob er bereit wäre, an einem Festival für israelische Kultur in der Ukraine teilzunehmen, wird Tal Schani, Autor in Israel, von einem russisch sprechenden Anrufer gefragt, einem Mann, der sich als Mitarbeiter für das "Forum für ehrenamtliche Fürsorge für jüdische Erziehung und Einwanderung" zu erkennen gibt. Schon in zwei Tagen ginge es los. Doch Tal Schani hat eigentlich keine Lust, "ich befinde mich gerade nicht in meiner ehrenamtlichen Phase", erwidert er.
Was ihn schließlich doch zum Einlenken bewegt, ist die Aussicht auf eine Begegnung: die Begegnung mit Tolik Schnajderman. Tolik ist Tals früheres Ich, der Junge, der 13 Jahre in der Ukraine lebte, bevor er vor über 20 Jahren nach Israel emigrierte.
Mit sieben Koffern ins gelobte Land
Noch im Flugzeug setzt Tals Erinnerung an Tolik ein: an Tolik mit dem Wollhandschuh, der am Ärmel seines Wintermantels baumelte, an die sieben Koffer, mit denen er und die Seinen ins gelobte Land aufbrachen, an ein kleines Mädchen mit Pudelmütze, das ihm einst am Bahnhof hinterher schrie, "es gibt kein Zurrrrrück!"
Er erinnerte sich, wie er da auf dem Bahnhof stand (...) Aber noch besser erinnerte er sich an das Gefühl, das ihn bedrängt und alles überschattet hatte. Die Traurigkeit, den Abschied, das Adrenalin, die Neugier. Ein beschissenes Gefühl. Er hatte sich als Betrüger gefühlt.
So beginnt Boris Saidmans starkes Debüt "Hemingway und die toten Vögel", ein autobiografisches Buch. Denn was diesem Tolik passiert ist, hat auch sein Alter Ego erlebt, der heute in Israel lebende Autor, der aus der ehemaligen Sowjetunion stammt.
Sechs verbundene Erzählungen
Boris Saidman, 45-jähriger Art Director aus Tel Aviv, wanderte Mitte der 1970er Jahre mit seinen Eltern nach Israel aus. Geboren wurde er 1963 in Kischinjow, heute Hauptstadt von Moldawien, dem ärmsten Land Europas. In "Hemingway und die toten Vögel" - eigentlich kein Roman, wie etikettiert, sondern ein Buch mit sechs selbstständigen Erzählungen mit Erinnerungen Tals alias Toliks an seine Kindheit und Jugend im fiktiven Dnjestrograd - wird eine Reise zurück ins Geburtsland zu einer Reise zurück in die Vergangenheit.
Alles hatte sich umgekehrt. (...) Das mächtige Imperium mit dem Namen UdSSR war im Betonmischer der Geschichte schon zerrieben worden und hatte sich in einen klebrigen, brodelnden Brei verwandelt, der sich selbst "Gemeinschaft Unabhängiger Staaten" nannte. Und das, was er einst gekannt hatte, existierte nicht mehr, außer dem kleinen Tolik.
Und diesen Tolik sieht der Erzähler mit geradezu "mikroskopischer Genauigkeit" vor sich, in Szenen, so detailscharf, als wären sie gestern geschehen.
Allein und anders sein
Toliks Jugend war geprägt von zwei einschneidenden Erfahrungen: Alleinsein und Anderssein. Als eines Tages der Vater nicht nach Hause gekommen war, wähnte Tolik ihn von einem deutschen Soldaten verhaftet und verschleppt. Er weiß, dass seine Familie anders als andere ist, dass bei ihm, bei Anatoli Jefimowitsch Schnajderman, im Pass unter Nationalität steht: Jude. Und dennoch ist er nicht glücklich, als eines Tages der Vater den Entschluss fasst, mit Frau und Kind zu emigrieren.
Ein antisemitisches Schlüsselerlebnis schildert die längste Erzählung dieses auch bedrückende Erfahrungen nie bleischwer, sondern mit großer Sensibilität und feiner Ironie schildernden Buches. Erzählt wird, wie Toliks Vater einen älteren Mitschüler bittet, auf dem Weg zur Schule ein Auge auf seinen Sohn zu haben. Doch dieser schubste ihn aus dem Trolleybus, rief ihm "jüdische Zecke" hinterher, und Tolik musste sich zu Fuß auf den langen, beschwerlichen Heimweg machen.
Die Welt der Bücher entdecken
Wie Boris Saidman persönliche Erlebnisse mit kollektiven Traumata überblendet, zeigt vor allem die erste Erzählung mit der Erinnerung an die Ausreise des jungen Tolik. Der Transport im Zug von Ost nach West und die Grenzkontrollen durch die Polizei weckten Assoziationen an Musterung und Deportation im Dritten Reich.
In der Titelgeschichte "Hemingway und die toten Vögel" erzählt Saidman von Tante Rosa, Onkel Niuma und Toliks Liebe zur Literatur. Sie spielt in jenem Sommer, in dem Niumas Rückkehr aus Sibirien erwartet wird, wo der Onkel wegen Unterschlagung 15 Jahre im Gulag verbringen musste. Tolik hat inzwischen die Welt der Bücher entdeckt - und ein Bild an der Wand, das er für ein Foto des Onkels hält. Doch der Mann mit dem Vollbart ist Hemingway. Der für Hemingway Gehaltene wiederum hatte in einem fast schon erfrorenen Vogel, den er vorm Kältetod rettete, das Symbol für die Rückkehr ins Leben erblickt.
Wiederbegegnung mit der Geburtsstadt
"Hemingway und die toten Vögel" ist ein spätes, aber sehr erfolgreiches Debüt. Es wurde in Israel zu einem der fünf besten Bücher des Jahres 2007 gewählt und in mehrere Sprachen übersetzt. Inzwischen hat Boris Saidman, der erstaunlich stilsichere Erzähler, sein zweites Buch auf Hebräisch abgeschlossen, wieder eine Immigranten-Geschichte.
Ob er bereit wäre, an einem "Festival für israelische Kultur" in seinem Geburtsland teilzunehmen, wurde Tal Schani gefragt. Die Antwort ist bekannt. Seine Reise in die Kindheit schildert Boris Saidmans brillanter, stark autobiographischer Band, der freilich nicht 1:1 eigene Erfahrungen widerspiegelt. Die Wiederbegegnung mit der Stadt der Herkunft hat auch Saidman erlebt, freilich erst nach der Veröffentlichung des Buches. Nicht immer folgt die Literatur dem Leben. Mitunter ist es auch umgekehrt.
Hör-Tipp
Ex libris, jeden Sonntag, 18:15 Uhr
Buch-Tipp
Boris Saidman, "Hemingway und die toten Vögel", aus dem Hebräischen übersetzt von Mirjam Pressler, Berlin Verlag
Link
Boris Saidman - Hemingway und die toten Vögel