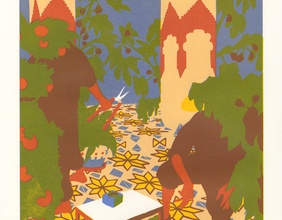Weidingers "organische Trompete"
Trompetenkonzert im Burgtheater
Am Burgtheater findet am 28. März 1800 ein Konzert statt, bei dem ein altes Instrument - in neuer Form - vorgestellt und gespielt wird. Haydn liefert die Musik für diese Premiere und zeigt damit, wie gut er mit neuen Entwicklungen umgehen kann.
8. April 2017, 21:58
Haydn örtlich - Teil 41
Der Programmzettel des kaiserlich königlichen National-Theaters nächst der Burg kündigt folgendes an:
Heute, Freytag, den 28. März 1800, wird Herr Anton Weidinger, K. K. Hof- und Theatertrompeter eine große musikalische Akademie mit Produzirung seiner organischen Trompete zu geben die Ehre haben. Die hierinn vorkommenden Stücke sind folgende:
1.) Eine ganz neue Symphonie von Herrn Joseph Haydn, Doctor der Tonkunst, und Kapellmeister bey Sr. Durchlaucht dem Hrn. Fürsten von Esterhazi.
2.) Wird Herr Anton Weidinger ein Konzert auf der von ihm erfundenen organischen Trompete, von der Komposition des obigen Meisters spielen.
3.) Singt Mlle. Gaßmann eine Arie von weiland Hrn. Mozart…
Noch eine Symphonie von Haydn, weitere Vokalmusik "von weiland Herrn Mozart" und noch allerhand Virtuoses für seine neue Trompete verspricht der Veranstalter.
Ein Monsterkonzert
Die Logen und gesperrten Sitze werden wie gewöhnlich bey der Kasse vergeben. Die Eintrittspreise sind wie gewöhnlich. Der Anfang ist um 7 Uhr.
Es wird ein rechtes Monsterkonzert, in dessen Mittelpunkt ein Musiker mit seinem Instrument steht, der sich, um die Zugkraft zu erhöhen, auch berühmte Gesangskräfte engagiert und sich vom zur Zeit berühmtesten Meister ein Werk schreiben lässt. Seine Erfindung, die "organische Trompete", ist epochal. Das Instrument wird mit Klappen ausgerüstet, die es ermöglichen, mehr als nur die Naturtöne zu spielen. Die Beschränkung auf dieselben hat die Trompete bisher nur begrenzt einsatzfähig gemacht und auch eine unterschiedliche Spezies von Trompetern hervorgebracht: etwa jene, die "Prinzipal" spielen und dann auch solche, die sich der "grob und faul"-Stimme zuwenden müssen.
Haydn nutzt das Neue genial
Mit Weidingers Erfindung bahnt sich Neues an - und Haydn weiß es genial zu nutzen. Schon nach der Rückkehr aus London wird er von Weidinger um ein Werk gebeten, in welchem die Vorzüge von dessen Trompete herauszuhören sind. Der Komponist schreibt 1796 als sein letztes Orchesterwerk ein Konzert in Es-Dur und stattet die Solostimme mit virtuosen Läufen und chromatischen Wendungen aus, die nur auf der Erfindung des Herrn Weidinger ausführbar sind.
Die technische Ausrüstung der Instrumente ist ein ständiges Interessensgebiet Haydns. Er pflegt mit den kreativen Klavierbaumeistern Schanz und Walter in Wien Gedankenaustausch und kümmert sich in Eisenstadt und Umgebung um neue Orgeln. Auch im Hinblick auf die Instrumente seines Orchesters weiß er Bescheid. Damit die in ihrem Tonumfang ebenfalls beschränkten Hörner in seiner "Abschiedssymphonie" die dort notwendigen abgründigen Tonarten blasen können, lässt er eigene Bögen bauen, welche den Instrumenten an den entsprechenden Stellen aufgesetzt werden.
Teilhabe am polyphonen Geschehen
Anton Weidinger hat also schon den rechten, nämlich den kundigen Meister gefragt um ein Konzert für seine "organische Trompete". Haydn schreibt ihm ein Stück, in welchem die Vorzüge der neuen Erfindung in musikalisch sinnvoller Weise zur Geltung kommen. Für vordergründiges und damit sinnloses Virtuosentum hat der Komponist zeitlebens nie etwas übrig.
Auch wenn er selbst Klavier oder Orgel spielt, dann ist er kein Hexenmeister, sondern ein kenntnisreicher Musiker, der natürlich auch einen guten Effekt zu schätzen weiß. Gut ist ein solcher Effekt aber nur dann, wenn er für das Ganze des Werkes einen Sinn ergibt. Das Trompetenkonzert gibt daher dem Soloinstrument den vielfältigsten Effekt, etwa auch dadurch, dass es am polyphonen Geschehen, welches im Orchester vor sich geht, teilhat.
Blick auf die Vergangenheit
Und noch ein Jahr vor dem Kaiserlied erfindet Haydn für den zweiten Satz des Konzertes eine feierliche Melodie im Sechsachteltakt, die wie der Hymnus mit den Initialtönen des gregorianischen "Pater noster" anhebt.
Wenn Haydn durch den Haupteingang aus dem Burgtheater heraustritt, dann steht er auf dem Michaelerplatz und kann genau auf das gegenüberliegende Haus Nr. 1220 schauen, in dessen Dachkammerl er vor Jahrzehnten mit Fleiß auch den Grundstein zu diesem reifen Meisterwerk gelegt hat.
Hör-Tipp
Apropos Klassik, jeden Montag, Mittwoch und Freitag bis einschließlich 22. Mai 2009, jeweils 15:06 Uhr
Übersicht
- Haydn örtlich