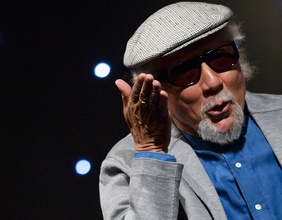Ein alternative Energiequelle
Algen im Tank
Für die Herstellung von Biodiesel aus Raps, Soja oder Palmöl werden meist wertvolle landwirtschaftliche Flächen genützt, die für die Nahrungsmittelproduktion fehlen. Die Lösung könnten Mikroalgen sein, die Biodiesel liefern und gleichzeitig CO2 binden.
8. April 2017, 21:58
Algen sind photosynthetisierende Pflanzen ohne Differenzierung in Blatt, Stamm und Wurzel und kommen nahezu überall vor - in Salz - und Süßwasser, auf Felsen im Gebirge und sogar in der Wüste, wo sie an der Unterseite von Steinen von Tau leben. Es gibt winzige einzellige Mikroalgen und bis zu baumgroße Makroalgen, die Untersee-Wälder bilden.
Algen produzieren 45 Prozent des Sauerstoffanteils
Algen sind in der Erdgeschichte auch die Vorfahren der Landpflanzen und haben durch die Fixierung von Kohlendioxid und die Ausatmung von Sauerstoff dafür gesorgt, dass die Erde für andere Lebewesen bewohnbar wurde. Auch heute noch produzieren sie 45 Prozent des Sauerstoffanteils der Atmosphäre.
Neben Kohlendioxid brauchen sie zum Leben Wasser, Sonnenlicht und Nährstoffe, wie Nitrat und Phosphat. Algen wachsen sehr schnell und können vieles nützen, was in der modernen Welt als Abfall anfällt: Abwasser, Abwärme und Abgas. Alle diese Eigenschaften machen Algen zu idealen Problemlösern für unseren Planeten, der unter einer Übermenge an Kohlendioxid und industriellen Abfällen leidet und enormen Energiebedarf hat. Weltweit beschäftigen sich deshalb mehrere Forschergruppen mit der Frage, wie Algen zur Kraftstoff-Produktion und Abgasverwertung genützt werden können.
Gesucht: Hoher Ölgehalt, schnelles Wachstum
Für die Biodiesel-Herstellung interessant sind die Mikroalgen, von denen es weltweit schätzungsweise bis zu 500.000 Arten geben soll. Davon sind aber erst rund 40.000 von Wissenschaftlern beschrieben. Einige Mikroalgen synthetisieren besonders viel Lipid, also Öl oder Fett, um ihre Schwimmlage einzustellen.
Umso mehr Öl eine Alge eingelagert hat, umso mehr treibt sie im Wasser noch oben, also näher zum Licht, das sie für die Photosysnthese und somit für die Vermehrung braucht.
Für die möglichst kostengünstige Biodieselherstellung suchen die Forscher nach einer besonders leistungsstarken Alge, die einen hohen Anteil an Lipiden enthält und gleichzeitig sehr schnell wächst. Sie untersuchen außerdem, ob man durch die Veränderung verschiedener Parameter, wie der Zusammensetzung der Nährlösung, der Menge an CO2 und dergleichen erreichen kann, dass eine Alge mehr Öl synthetisiert.
Wie kultivieren?
Der Prozess der Herstellung von Biodiesel aus Algen sei im Prinzip entwickelt, so Heike Frühwirth, Forschungsleiterin bei der Firma Biodiesel International in Grambach bei Graz, die sich seit drei Jahren mit diesem Thema beschäftigt. In Zusammenarbeit mit Michael Schagerl vom Department für Marinebiologie der Universität Wien, der sich seit 20 Jahren mit Algen beschäftigt, sucht man nun nach der am besten geeigneten Alge und der bestmöglichen Kultivierung.
Eine Schwierigkeit ist, dass sich die Mikroalgen bei der Massen-Kultivierung in größeren Behältern rasch selbst beschatten und damit nicht mehr ausreichend Photosynthese betreiben können. Für die Kultivierung von Mikroalgen für die Nahrungsmittel- und Kosmetikindustrie werden seit einigen Jahren in gemäßigten Klimazonen, wie zum Beispiel in Deutschland, Röhren-Bioreaktoren verwendet, die der Potsdamer Biotechnologe Otto Pulz entwickelt hat.
In Klötze in Sachsen-Anhalt steht seit dem Jahr 2000 die größte Algenproduktionsanlage mit 500 Kilometer Glasröhren, die pro Jahr 130 Tonnen Algen für Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetika produziert. Weitere Varianten sind Plastiksäcke und sogenannte Flatpanel-Bioreaktoren, die wie Stegplatten aus Acrylglas aussehen, die für Gewächshäuser und Vordächer verwendet werden.
Sollen Algen in großem Maßstab für die Biodiesel-Produktion gezüchtet werden, so ist es wichtig, die Kosten dafür möglichst gering zu halten. Auch dafür suchen mehrere Forschergruppen nach der idealen Lösung, die aber immer auch auf den jeweiligen Standort und die jeweilige Algenart abgestimmt werden muss.
Gewächshäuser für Algen
Weil Mikroalgen nicht die extremen Temperaturunterschiede gemäßigter Zonen von minus 30 bis plus 35 Grad aushalten, wird es notwendig sein, die Algen-Bioreaktoren mit Glashäusern oder Folientunneln zu schützen, meint die Algenforscherin Carola Griehl, Professorin am Department für Angewandte Biowissenschaften und Prozesstechnologie der Hochschule Anhalt in Köthen.
Flache Acrylglas-Bioreaktoren, aufgestellt unter einem Glashaus - so sieht auch der Algen-Bioreaktor-Entwurf von Franz Emminger und Martin Mohr aus. Der Verfahrenstechniker und der Projektentwickler haben dafür in Hainburg die Firma Ecoduna gegründet. Für ihren sogenannten "hanging garden" haben sie Ende Jänner den Genius Ideenwettbewerb der niederösterreichischen Gründeragentur RIZ gewonnen.
Ihre Idee war, den Energieeinsatz für die Kultivierung von Algen so weit wie möglich zu reduzieren, um damit die Wirtschaftlichkeit und die ökologische Bedeutung zu erhöhen. Dafür werden die Stegplatten senkrecht aufgehängt und können sich der Sonne nachdrehen, sodass die darin befindliche Algenlösung immer maximales Streulicht erhält.
Die Stege sind oben und unten offen, sodass die Lösung in Zick-Zack-Form durchfließen kann. Wird beim Auslass Algenlösung entnommen, so fließt aufgrund des hydrostatischen Druckausgleichs beim Einlass Algenlösung nach. Durch das Einblasen von CO2, das die Algen zum Wachstum brauchen, könnte die Flüssigkeit zusätzlich bewegt werden.
An der Oberseite sind die Stegplatten soweit offen, dass der von den Algen erzeugte Sauerstoff entweichen oder abgeleitet werden kann, zum Beispiel für den Verbrennungsprozess eines angeschlossenen Kraftwerkes, von dem wiederum Abwärme und CO2 für die Algen kommen.
Ein Prototyp des „hanging garden“ steht bereits in der Werkstatt von Ecoduna in Hainburg, als nächstes soll in Niederösterreich eine Pilotanlage gebaut werden.
Perfekte Kreislaufwirtschaft
In Deutschland gibt es auch schon zwei Pilotanlagen bei Kohlekraftwerken von RWE und EON, mit denen untersucht werden soll, inwieweit man Algen überhaupt mit Kraftwerksabgasen füttern kann. Denn diese enthalten ja nicht nur Kohlendioxid, sondern auch Schwefeldioxid, Stickstoffmonoxid oder Stickoxide, betont die Algenforscherin Carola Griehl.
Sie untersucht auch die Kombination von Algenbioreaktor und Biogasanlage. Das bei der Biogasgewinnung entstehende CO2 könnte zur Kultivierung der Algen dienen, statt es in die Atmosphäre zu schleudern, die Algenbiomasse, die bei der Lipidgewinnung übrigbleibt, könnte wiederum als Nährstoff für den Biogasreaktor dienen.
Wasser und Nährstoffe für die Algenkultivierung wiederum könnten von Abwasser kommen, das damit gleichzeitig gereinigt wird. Zumindest in der Theorie ist die Züchtung von Mikroalgen eine perfekte Kreislaufwirtschaft zur Entsorgung von Abfällen und gleichzeitigen Produktion von Energie.
Algen werden das CO2-Problem sicherlich nicht zur Gänze lösen können, sie könnten aber einen wichtigen Beitrag liefern. Immerhin binden Mikroalgen Kohlendioxid in fast der doppelten Menge ihrer Biomasse und liefern 50 bis 60 mal so viel Biodiesel pro Hektar wie Raps.
Hör-Tipp
Dimensionen, Donnerstag, 5. März 2009, 19:05 Uhr
Links
Carola Griehl
Michael Schagerl
Biodiesel International
Ecoduna