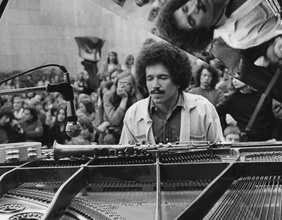Wie Musik das Jenseits fantasiert
Töne von Drüben
Die Musikgeschichte ist gesättigt mit Vorstellungen des Imaginären. Musik fantasiert alle Arten von Jenseits, nicht nur das christliche Paradies. Auch in der Neuen Musik und sogar der Popmusik ist das Interesse an Transzendenz höher, als man denkt.
8. April 2017, 21:58
Irena Grafenauer war im Paradies.
Bob Dylan erzählte vom Anklopfen an der Himmelstür ("Knocking on Heaven’s Door"), und dass der Tod nicht das Ende ist ("Death is Not the End"). Led Zeppelin sahen eine Treppe in den Himmel ("Stairway to Heaven"). Ein ganzes Genre der Popmusik nennt sich "Trance". In der Konzertsaalmusik der letzten 50 Jahre finden sich Werktitel wie "De Terrae Fine" ("Vom Ende der Welt"), "Enigma", "Tempus ex Machina", "Apparitions" ("Erscheinungen"), "Donnerstag aus Licht".
Würde ein zeitgenössischer Maler oder Medienkünstler seine Arbeiten so betiteln, dann hätte er Schwierigkeiten, ernst genommen zu werden. Bei Musik herrschen weniger Berührungsängste gegenüber dem Magischen, Mythischen, Transzendenten. Der Gregorianik-Boom ist der beste Beweis dafür.
Peter Oswald, der mit Barbara Fränzen das Neue Musik-Label "Kairos" betreibt, sieht den Grund darin, dass Musik "das Angesprochene nicht beim Namen nennen muss. Gerade dadurch ist sie dazu prädestiniert, etwas zu formulieren, ohne das Formulierte ans Banale zu verraten."
Imaginäre Räume
Hans Werner Henzes Orchesterstück "Barcarola" handelt von Fährleuten, die Sterbende über den antiken Totenfluss Styx bringen; der gläubige Katholik Olivier Messiaen wollte in Werken wie "Éclairs sur l’Au-Delà" ("Streiflichter über das Jenseits") die Hörer "in die Welt spiritueller Wahrheiten transportieren".
Die Tendenz zur Überschreitung des Erklärbaren muss sich nicht in so expliziten Jenseits-Bezügen äußern. In der Musik des 20. und 21. Jahrhunderts läuft Transzendenz oft auf imaginäre, illusionäre Räume hinaus. Beim Erklingen eines Stücks von Giacinto Scelsi zum Beispiel bilden sich förmlich Raumfiguren - man hört sie, könnte sie aber schwerlich aufzeichnen.
Es ist kein Zufall, dass sich Komponisten heute brennend für wissenschaftliche Theorien über eine vierte und fünfte Dimension oder die Krümmung der Raumzeit interessieren.
Aufhebung der Zeitlichkeit
Durch Musik Zeitlosigkeit zu suggerieren, fasziniert viele Komponisten. Beat Furrer benannte ein Werk für zwei Klaviere und Ensemble nach der bretonischen Göttin "Nuun", die laut Mythos die Zeit anhalten konnte. György Ligeti kommentierte sein Chorstück "Lux Aeterna" folgendermaßen: "Evoziert wird die Vorstellung von Unendlichkeit, erweckt wird der Eindruck, dass die Musik bereits da war, als wir sie noch nicht hörten, und immer fortdauern wird, auch wenn wir sie nicht mehr hören".
Zeitlosigkeit kann umgekehrt bedeuten, für Momente völlig in der Gegenwart zu leben; man vergisst ja dann auf die Zeitlichkeit. So erlebt es Pater Maximilian Krenn, Kantor im Stift Göttweig, beim Singen der Vespern im gregorianischen Choral: "Ich meine, dass das Gebet und speziell der gregorianische Choral uns wirklich in der Gegenwart sein lässt. Also ein Stück Arbeit, nämlich die Denkleistung, kommt zur Ruhe. Es ist weniger ein Abheben, sondern eigentlich ein Herunterkommen, oder ein zu mir finden."
Nahtoderfahrung einer Musikerin
Musik und die Frage eines Weiterlebens nach dem Tod verbinden sich auf besondere Weise im Leben der Flötistin Irena Grafenauer. Sie lag zweimal im Koma und hatte sogenannte Nahtoderfahrungen. Menschen, die so gut wie tot waren und dann weiterleben, berichten häufig über einen Tunnel mit Licht am anderen Ende; und darüber, sich selbst außerhalb des eigenen Körpers erlebt zu haben. So auch Irena Grafenauer: "Sterben ist das Allerschönste. Im Leben gibt es nichts Vergleichbares."
Musik hat sie dabei nicht gehört. Aber die Stimmung jener unvergesslichen Erlebnisse findet sie in vielen Musikwerken wieder - bei Bruckner, Schubert und anderen. Ob im Jenseits - falls es denn existiert - Musik erklingt? "Ich denke, irgendwelche Töne. Aber sicher nicht die gleiche Musik. Vielleicht ist es gerade die Musik, die so speziell ist auf dieser Erde."
Hör-Tipp
Radiokolleg, Montag, 6. April 2009, bis Donnerstag, 9. April 2009, 9:45 Uhr