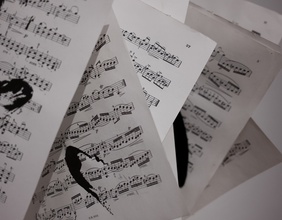Bedürfnis oder Leistung
Die Gerechtigkeit im Wandel der Zeit
Gerechtigkeit beschreibt den Idealzustand menschlichen Zusammenlebens. Besonders dann, wenn es um kollidierende Interessen geht, stellt sich die Frage, was gerecht ist. Wenn Ressourcen knapp sind, gibt es Streit. Wem steht was zu?
8. April 2017, 21:58
Aristoteles beschreibt die Gerechtigkeit als widersprüchlichen Begriff und unterscheidet drei Dimensionen, die bis zum heutigen Tag gelten. Zum einen ist es gerecht, wenn jemand bekommt, was er braucht. Ein kleines Kind beispielsweise bekommt mehr Zuwendung als ein großes. Aristoteles nennt das Bedürfnisgerechtigkeit.
Zum anderen gibt es die Leistungsgerechtigkeit: Wer mehr leistet, bekommt mehr. Ein Kind also, das bessere Noten in der Schule hat, bekommt eine größere Belohnung als ein Kind, das schlechte Noten hat.
Diese beiden Dimensionen der Gerechtigkeit stehen aber zueinander im Widerspruch. Es ist nicht möglich dieselbe Ressource nach Bedürfnis und Leistung zu verteilen. Deshalb muss es ein Ordnungsprinzip geben, das die Aufteilung zwischen Bedürfnis und Leistung überwacht, die Gesetzesgerechtigkeit oder die Politik.
Die Kardinaltugend
Im antiken Griechenland schreibt man der Gerechtigkeit einen göttlichen Ursprung zu. Sie gilt als absolut und nicht als vom Menschen beeinflusst, definiert und geschaffen. Für Platon ist Gerechtigkeit eine ewige, unveränderliche Idee.
Gerechtigkeit an sich gilt als Gut, das anzustreben ist. Deshalb ist die Gerechtigkeit eine der vier Kardinaltugenden. Gemeinsam mit Mut, Besonnenheit und Weisheit ist sie die höchste menschliche Grundhaltung.
Gerechtigkeit für jeden?
Schon in der Antike gilt die Gerechtigkeit nur für freie Männer. Frauen und Sklaven haben keinen Anspruch auf gerechte Behandlung. Diese Idee der Antike setzt sich bis ins Mittelalter fort. Thomas von Aquin, beeinflusst durch das Christentum, überlegt sich, dass alle Menschen Gott ebenbildlich sind, und dass deshalb die Gerechtigkeit eigentlich für alle gelten müsste. Dennoch unterscheidet auch er zwischen Herr und Knecht. Auch Frauen empfindet er nicht als vollwertiges Subjekt der Gerechtigkeit.
Dieses Bild bessert sich in der frühen Neuzeit und in der Aufklärung. Es kommt die Forderung nach Menschenrechten auf, beispielhaft bei John Locke und Immanuel Kant. Aber immer noch sind es vor allem weiße Männer, von denen die Rede ist. Das sieht man zum Beispiel in der damaligen französischen Verfassung, in der dunkelhäutige Menschen und Frauen als "homme manqué", also Mängelwesen, ausgeschlossen wurden aus dem Bereich der gleichen Freiheit. Die Vorstellung, dass Gerechtigkeit für alle Menschen gleichermaßen gilt, kann sich noch nicht ganz durchsetzen. Das beginnt erst so richtig im 19. Und 20. Jahrhundert.
Gerechtigkeit und Nützlichkeit
Eine richtige Blütezeit erlebt die Gerechtigkeitsdebatte im späten 19. Jahrhundert. John Stuart Mill, ein englischer Philosoph und Utilitarist, ist der Meinung, dass Gerechtigkeit nützlich und daher gut für den Menschen ist. Ressourcen werden dann gerecht verteilt, wenn sich diese Verteilung als nützlich erweist.
Diese Begründung kann gefährlich werden. Schließlich könnte man behaupten, dass es nützlich ist, wenn zehn Menschen hunderte andere Menschen versklaven und für sich arbeiten lassen. Der Utilitarismus kann sich vor solcher Kritik nur schützen, wenn er neben dem Prinzip der Nützlichkeit auch ein Prinzip der Anerkennung jeder Person als gleichermaßen frei inkludiert.
Das Prinzip der Freiheit
Bis in die 1970er Jahre gibt es kaum Debatten über die Gerechtigkeit. Dann kommt der amerikanische Philosoph John Rawls, der mit seinem Buch "Eine Theorie der Gerechtigkeit" das Thema aufgreift. Er versucht Altes und Modernes miteinander zu verknüpfen und zu einer brauchbaren, liberalen Gerechtigkeitskonzeption zu führen, die aber andererseits auch sozial ist.
Sein Grundprinzip ist die Freiheit aller Menschen, dennoch müssen ökonomische und soziale Unterschiede ausgeglichen werden. Absolute Gleichheit, so John Rawls, kann es nicht geben, denn sonst würde man ständig in das Leben der Menschen eingreifen und deren Freiheit stören. Die sozialen und ökonomischen Ungleichheiten sollen aber erträglich sein, also nicht zu groß werden. Nach John Rawls gab es viele andere moderne Theorien der Gerechtigkeit, die sich aber alle auf ihn beziehen.
Nichts Absolutes
Bei diesem Streifzug durch 2.500 Jahre Gerechtigkeit wird klar, dass sie nicht nur eine Frage der Persönlichkeit ist, sondern auch eine Frage der Gesellschaft. Denn was Gerechtigkeit ist, wird an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeiten auf unterschiedliche Weise beantwortet. Daher ist Gerechtigkeit nichts allgemein Gültiges und Absolutes.
Hör-Tipp
Salzburger Nachtstudio, Mittwoch, 2. Dezember 2009, 21:01 Uhr