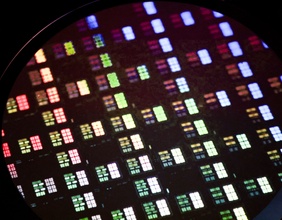Wiederveröffentlichter Roman von Magda Szabó
Die Elemente
Bevor Imre Kertész den Nobelpreis erhielt und das Werk von Sándor Márai postum zum internationalen Verkaufserfolg wurde, war sie die berühmteste Schriftstellerpersönlichkeit Ungarns: die 2007 im Alter von 90 Jahren verstorbene Magda Szabó. Nun hat der neue, in Zürich ansässige Verlag Secession eine Neuübersetzung ihres im Original 1963 erschienenen Romans "Pilatus" herausgebracht.
8. April 2017, 21:58
Der Generationenroman gibt zugleich Einblick in die ungarische Gesellschaftsgeschichte, eine psychologisch genaue Milieustudie, die nie psychologisiert und deren Personen mehrmals in einem anderen Licht erscheinen; manche ihrer Geheimnisse lösen sich erst gegen Schluss, aber zu Tode erklärt werden sie auch dann nicht.
Zu perfekt umsorgt
In einer ostungarischen Kleinstadt leben der Richter Vince Szöcs und seine Frau Etelka. Vince wurde 1923 zwangspensioniert, weil er vier streikende Bauern nicht verurteilt hatte, wie es von ihm verlangt worden war; erst 1946 wurde er rehabilitiert, aber da hatte er schon nicht mehr lang zu leben. Seine Tochter Isa, die gute, tapfere und kluge Frau, organisiert seine medizinische Behandlung, als bei ihm Magenkrebs diagnostiziert wird, und als er stirbt, nimmt sie die Mutter zu sich nach Budapest.
In subtilen, quälenden Nahaufnahmen wird gezeigt, wie alle Wünsche von Etelka, ihre ganze bisherige Lebensform, sinnlos wird, weil so gut für sie gesorgt ist, dass ihre Arbeit, ihre Pläne nicht mehr gebraucht und überflüssig werden. Der Roman braucht nur wenige einfache Sätze, um Etelkas ganzes Elend offenbar werden zu lasen:
Tag für Tag sagte sie sich Iza auf, die sie nicht in ihrem alten Haus allein ließ, alles für sie erledigte, ihr die Arbeit aus der Hand nahm, für sie sorgte, sie mit allem Denkbaren überhäufte. Dann weinte sie lange, ratlos und voller Scham.
Keine Sehnsucht nach der Heimat
Etelka macht alles falsch, Etelka blamiert ihre Tochter, Etelka kann mit den neuen Geräten nicht umgehen. Nach all den gutgemeinten Geschenken und Hilfen sagt Etelka zu Iza, die sie wieder einmal ausschimpft: "Morgen bin ich ohnehin nicht mehr da. Tu mir nichts." Etelka fährt in die alte Heimat, denn der Grabstein für Vince ist fertig.
Iza bleibt in der Stadt, Iza ist eine bekannte Ärztin und hat zu tun. Sie will auch nicht gerne in die Kleinstadt – zum einen, weil sie das Leben dort hasst, zum anderen, weil Antal dort lebt, ihr geschiedener Mann. Warum er, der Iza liebte und keine andere Frau hatte, sich von ihr, die ihn liebte und keinen anderen Mann hatte, scheiden ließ, begreift niemand; man muss den Roman zu Ende lesen, um es zu verstehen.
Vielleicht hat er selbst es erst ganz verstanden, als er Lídia kennenlernt, die Krankenschwester, die Vince in seinen letzten Tagen begleitet hat; da, so beschreibt es der Roman "fühlte er sich wie einer, der in einem fremden Land plötzlich in seiner Muttersprache angesprochen wird". Lídia und Iza, die beiden könnten unterschiedlicher nicht sein:
Iza war Soldat, Schicksalsgefährte, mit der er ein Stück Wegs zurückgelegt hatte. Lídia, sobald er angefangen hatte, sie zu lieben, gab ihm nie das Gefühl, dass sie mit ihm mitkam, ihn begleitete: Lídia war irgendwie identisch mit ihm selbst, sie behielten oder wechselten die gemeinsame Richtung instinktiv, nicht deshalb, weil sie es so besprochen hatten.
Bürgerliche Welt
Lídia hatte Vince verstanden und seine Sehnsucht nach dem Ort seiner Herkunft, der auch ihr Geburtsort war. Und Lídia steht am Schluss auch Etelka in ihren letzten Stunden bei, nachdem sie auf der Suche nach dem Anfangsort ihrer Liebe zu Vince verunglückt ist. Die Aufklärung des Unglücks wird auch zur Aufklärung der Beziehungen. Iza verliert ihren Geliebten, den Schriftsteller Domokos, und wendet sich den toten Eltern zu. Doch, so die allerletzten Worte des Romans: "Die Toten antworteten nicht."
Die Schlüsselsätze zum Scheitern Izas kommen von Lídia:
Die Unglückselige glaubt, die Vergangenheit der Alten sei ein Feind, und bemerkt nicht, dass sie Erklärung, Maß und Deutung der Gegenwart ist.
Riskante Sätze im Ungarn des Jahres 1963, wo der Kommunismus allen eine helle Zukunft verheißt und man sich von der Vergangenheit, vor allem der bürgerlichen, befreien sollte. Magda Szabó setzt in diesem wie in vielen anderen ihrer über 40 Romane aber vor allem diese bürgerliche Welt in Szene und hat die Individualität und Unverwechselbarkeit ihrer Romanfiguren im Blick.
Die Autorin, die von 1949 bis 1959 Publikationsverbot hatte und aus dem Staatsdienst entfernt wurde, konnte solche Sätze wahrscheinlich nur in den Roman einschmuggeln, weil die Grundkonstellation ihrer Figuren zunächst systemkonform war: der vom Horthy-Regime zu Unrecht pensionierte Vince, die tapfere Iza, die im Krieg Flugblätter verteilt hatte, die Aufstiegschancen, die ihr und Antal im Kommunismus offenstehen. Doch die Demaskierung der so forsch und fortschrittlich alles organisierenden Iza, der Unschuldigen – darum heißt der Roman im Original "Pilatus", kann man auch als Demaskierung des Systems lesen.
Zeitgemäße Übersetzung
Heute, wo diese Lesart historisch geworden ist, fasziniert Magda Szabós Roman immer noch. Die große sprachliche Konzentration, die in wenigen einfachen Sätzen Außen- und vor allem Innenwelten einstürzen lassen kann, die genau ausgeleuchteten Gesten und Alltagsfragmente, das alles geht auch heute unter die Haut, besonders in der neuen Übertragung von Heinrich Eisterer, dem diesjährigen Träger des Österreichischen Staatspreises für literarische Übersetzung.
Im Vergleich mit der 1964 unter dem Titel "... und wusch ihre Hände in Unschuld" wirkt sie entschlackt und so gleichzeitig näher dem Original wie auch zeitgemäßer; und sie traut dem Leser die ungarischen Namen zu. Sprachliche Ungeschicklichkeiten wie "niemand der jungen Menschen", wo es "keiner der jungen Menschen heißen müsste", oder "weinte sie ein Stück" fallen nicht ins Gewicht, auch das modisch-schnoddrige "sie ... brummte nicht mal" kommt nur einmal vor.
Dass bereits in der fünften Zeile des Romans die Brotscheiben zu "Brotschreiben" werden, verheißt in Sachen Satzfehler nichts Gutes, und tatsächlich kann man noch etliche andere derartige Fehler finden, etwa "Regelmäntel" statt "Regenmäntel". Im Vergleich mit dem konsistenten und konsequenten sprachlichen Duktus dieser Übersetzung sind das dennoch Kleinigkeiten.
Dass der Roman jetzt "Die Elemente" heißt, rückt das Bauprinzip in den Vordergrund: die vier Kapitel sind mit "Erde", Feuer", "Wasser", "Luft" überschrieben. Was deutlich macht, dass Magda Szabó mehr will als eine Geschichte erzählen. Die Welt, die sie im Roman erzähltechnisch genial entfaltet, kann einen sehr schnell in die selbst erfahrenen Klüfte zwischen den Generationen und die Erfahrungen mit alt gewordenen Eltern hineinkatapultieren. Dieser Klassiker der ungarischen Literatur des 20. Jahrhunderts lässt sich nicht so einfach ins Museum entsorgen.
Service
Magda Szabó, "Die Elemente", aus dem Ungarischen übersetzt von Heinrich Eisterer, Secession Verlag für Literatur
Secession Verlag - Die Elemente