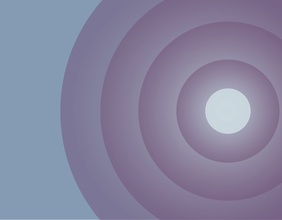Kompetenzzentrum in Ton und Text
20 Jahre Radio-Wetterredaktion
Die Radio-Wetterredaktion begeht ihr 20-jähriges Jubiläum. Inzwischen steigern immer schnellere Großrechenanlagen die Qualität der Wettervorhersage. Die Wetterredakteure sind ausgebildete Meteorologen und bilden ein meteorologisches Kompetenzzentrum: Neben den Radioformaten liefern Sie auch die Inhalte für das Wetter im ORF-Teletext und für wetter.ORF.at
8. April 2017, 21:58
Mittagsjournal, 11.05.2011
14 Redakteure
Die Hörfunk-Wetterredaktion wurde vor rund 20 Jahren im Auftrag des damaligen ORF Generalintendanten Gerd Bacher gegründet. Die Fernseh-Wetterredaktion gab es schon etwas länger, im Radio kamen die Wetterberichte bis zum Jahr 1991 dagegen von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. Die Idee hinter der Gründung war die Etablierung einer Fachredaktion in der "gelernte" Meteorologen mit journalistischer Zusatzausbildung die Wetterinformation für das Radio erstellen und auch präsentieren. Zunächst bestand sie aus nur wenigen Mitgliedern, über die Jahre ist sie jedoch mit immer größer werdendem Leistungsumfang gewachsen. Aktuell besteht sie aus 14 Redakteuren. Die meisten davon haben das Diplomstudium der Meteorologie ganz, wenige fast abgeschlossen. Alle sind Prognostiker mit jahrelanger Erfahrung, die zusätzlich zur Fachausbildung journalistische und sprechtechnische Schulungen absolviert haben. Geleitet wurde die Wetterredaktion die ersten 18 Jahre von Dr. Peter Sterzinger, dann zwei Jahre von Mag. Herbert Kartas und seit März 2011 macht das Michael Mattern interimistisch.
Netzwerk von Supercomputern
Basis für die Prognosen sind die Computermodelle von ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) und Meteo-france. Ersteres wird in Reading in England gerechnet, zweiteres in Toulouse. In beiden Fällen erledigen das echte Supercomputer (schaffen 30 bis 80 Billionen Rechenschritte pro Sekunde). Diese Computer errechnen Vorhersagekarten, Diagramme und Tabellen für die nächsten Tage. Die Redaktion schaut sich die Werte laufend an und leitet daraus ihre Prognosen ab. Diese muss man dann allerdings ständig mit der Realität in Einklang bringen, quasi schauen - ob die Modelle richtig oder falsch liegen.
Das aktuelle Wetter liefern rund 250 Wetterstationen, die alle zehn Minuten die wichtigsten meteorologischen Parameter messen (Temperatur, Luftdruck, Wind, Luftfeuchte, Sonnenscheindauer und ein paar mehr). Satellitenbilder, Regenradar (zeigt die Verteilung, Intensität und Bewegung von Regen-, oder Schneefallgebieten, bei Gewittern auch Hagel) und ein Blitzortungssystem (zeigt binnen einer Minute wann und wo der Blitz eingeschlagen hat).
Meteorologie muss übersetzt werden
Dabei handelt es sich genau genommen um Atmosphärenphysik, die man grob in einen theoretischen und prognostischen (synoptischen) Bereich gliedern kann. Die Theoretiker entwickeln auf der Basis mathematisch-physikalischer Gleichungen komplexe Computersimulationsmodelle mit denen sich das Verhalten, der Zustand der Atmosphäre in der Zukunft berechnen lässt. Diesen zukünftigen Zustand kann man in Form von Wetterkarten, Prognosediagrammen und vielem mehr darstellen. Jetzt kommt der Prognostiker (die Wetterredaktion) ins Spiel. Die Kunst der Synoptik ist es die Ergebnisse der Berechnungen mittels Erfahrung noch einmal zu verfeinern und für den Laien zu übersetzen (Bsp. zu wissen wo man das Computermodell bei der Temperaturprognose nachbessern muss, zu wissen an welchem Ort und bei welcher Wetterlage die Niederschlagsprognose zu hoch oder zu niedrig ausfällt, der Wind über- oder unterschätzt wird). Diese Aufgabe ist umso spannender, aber auch umso schwieriger je komplexer die Orografie (Landschaft - Gebirgigkeit) eines Landes (in einem Tal ist das Wetter so, im nächsten schon wieder anders) ist. Und die Orografie von Österreich ist schön, aber sehr kompliziert, für den Meteorologen eine entsprechende Herausforderung.
Kunst der Knappheit
Die fast noch größere Herausforderung ist es aber, das was man über das zukünftige Wetter weiß (und das ist manchmal viel und gesichert) in 30 oder 60-Sekundentexte zu fassen, so dass möglichst wenig von diesem Wissen verloren geht. Das Wetter in Österreich ist oft so komplex, dass selbst das Beschreiben des gestrigen und damit (eindeutig klaren) Wetters in 30 Sekunden unmöglich ist. Im Unterschied zum TV hat die Wetterredaktion beim Radio auch keine Bildunterstützung, es bleibt daher nur die Sprache. Oft entstehen sogenannte Fehlprognosen aus der Unmöglichkeit, die Komplexität des Wetters in so kurze Prognosetexte zu fassen.
Spezialitäten
Zu den täglichen Routineprodukten bietet die Radio-Wetterredaktion auch noch Spezialitäten wie das Agrarwetter, das SMS-Wetter bei Ö3, die Ö3-Wettershow in den Ferien und seit 2003 die Wetterwarnungen an. In Kooperation mit der ZAMG wird dabei auf Ö3, im Internet und Teletext speziell vor potentiell gefährlichen Wettererscheinungen (Gewitter, Sturm, Hagel, Hochwasser, Starkschneefall, Glatteis,..) gewarnt.
In Kooperation mit der Uni-Salzburg arbeiten wir außerdem an einem Projekt, in dem die Verständlichkeit von Wettertexten untersucht wird. Problemstellungen wie "Was kommt beim Hörer an?" - Welche Begriffe im Wetterbericht kann der Hörer richtig einordnen - wo kommt es zu Unklarheiten?" - Wie formuliert man einen Prognosetext möglichst verständlich und eindeutig?" uvm. werden anhand von Umfragen untersucht.
Service
Übersicht
- Medien