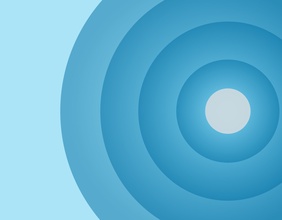Bibelkommentar zu Johannes 6, 60 - 69
Dieser Bibeltext erinnert Martin Jäggle daran, dass christlicher Glaube riskante Beziehung ist, auf Erfahrung beruht und Freiheit braucht.
8. April 2017, 21:58
In jener Zeit sagten viele Jünger, die ihm zuhörten: Was er sagt, ist unerträglich. Wer kann das anhören? Jesus erkannte, dass seine Jünger darüber murrten, und fragte sie: Daran nehmt ihr Anstoß? Was werdet ihr sagen, wenn ihr den Menschensohn hinaufsteigen seht, dorthin, wo er vorher war? Der Geist ist es, der lebendig macht; das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sind Geist und Leben. Aber es gibt unter euch einige, die nicht glauben. Jesus wusste nämlich von Anfang an, welche es waren, die nicht glaubten, und wer ihn verraten würde. Und er sagte: Deshalb habe ich zu euch gesagt: niemand kann zu mir kommen, wenn es ihm nicht vom Vater gegeben ist. Darauf zogen sich viele Jünger zurück und wanderten nicht mehr mit ihm umher. Da fragte Jesus die Zwölf: Wollt auch ihr weggehen? Simon Petrus antwortete ihm: Herr zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir sind zum Glauben gekommen und haben erkannt: Du bist der Heilige Gottes.
Mit Kaiser Konstantin hat es angefangen und bald war es entschieden: Christsein ist im Römischen Reich gesellschaftlicher Standard geworden. Es gehörte zum Normalsten der damaligen Welt, Christ zu sein – in Europa tausendfünfhundert Jahre lang. Verdrängt wurde das eben gehörte Evangelium, demnach christlicher Glaube überhaupt nicht normal oder gar selbstverständlich ist, sondern auch als etwas Skandalöses erscheint.
In Europa fällt es in religiösen Fragen schwer, sich auf klare Entscheidungen festzulegen. Religiös unverbindlich zu bleiben ist verständlich angesichts einer Geschichte, die vielfach gelehrt hat, welche Folgen allzu feurige Überzeugungen mit sich bringen können. Umso befremdlicher muss es wirken, wenn Jesus hier eine Situation zuspitzt und dazu herausfordert, entschieden zu entscheiden, so oder so, jedenfalls aber auf der Grundlage von Erfahrung und in Freiheit.
Von Beginn an ist die Krise Teil christlicher Gemeinden und christlichen Glaubens. Auch die Gemeinde, für die Johannes sein Evangelium niederschreibt, ist in der Krise. Ein Teil der Johannesgemeinde wendet sich schon ab. Sie murren wie die Jünger Jesu, die auf dem Weg mit ihm schon lange zahlreiche Entbehrungen auf sich genommen haben. Die Reaktion der Zuhörer zeigt: Jesus entspricht nicht ihren Erwartungen, ist nicht so, wie sie es sich wünschen. Das Befremdliche der Botschaft geht ihnen zu weit. Es ist für sie unerträglich. Jesus entzieht sich, er entspricht nicht ihren Erwartungen, er erfüllt nicht ihre Wünsche An Jesus scheiden sich die Geister. Und es gibt viele Gründe, an ihm Anstoß zu nehmen. Da ist die Radikalität, in der er aus Gott lebt und den Menschen leben hilft. Da ist der Anspruch, den er für das Evangelium und sich selbst erhebt. Die entscheidende Szene hier ist frei von jeglichem Charakter einer Gerichtsverhandlung, wo verhört, geprüft, beurteilt oder verurteilt wird. Die Jünger insgesamt und mit ihnen die Zwölf haben alle Freiheit, dorthin zurückzukehren, wo sie vorher Zuhause waren, oder mit Jesus weiter mitzugehen. Hier wird nicht einfach von einer Meinungsverschiedenheit erzählt. Jene Jünger, für die der Anspruch Jesu unerträglich ist, geben ihre Lebens- und Lerngemeinschaft mit ihm auf. Sie verlassen ihn und kehren in ihre gewohnte Umgebung zurück.
Was für ein Mensch jemand ist, kann man daran erkennen, wie er handelt und was er sagt. Zugleich erschließt sich aber die Bedeutung eines Menschen von außen nicht eindeutig und nicht zwingend. Ein Kuss kann Liebe oder Verrat bedeuten. Wer ein Mensch wirklich ist, was er für mich und andere bedeutet, kann man letztlich von außen nicht erkennen, Es kann aber so manchem von uns aufgehen. Es erschließt sich jenen, die ihn lieben. Erkennen und Glauben wird möglich.
Die Antwort des Petrus beruht auf Erfahrung. Der Glaube der Zwölf - und der Jünger, die bleiben, - ist kein blinder Glaube. "Wir haben erkannt", sagt er. Ihr Glaube hat gute Gründe. Es ist die Erfahrung von Menschen, die sich ansprechen haben lassen, die riskiert haben, den Weg mit Jesus mitzugehen und die so in das Bekenntnis hineingewachsen sind. Petrus kann aus Erfahrung feststellen: „Du bist der Heilige Gottes!“ Wir haben erkannt, uns ist aufgegangen, du gehörst untrennbar zu Gott. Sie haben erprobt, wie tragfähig alles ist, was Jesus sagte über das Leben, über sich selbst, die Welt, über Gott. Es war eine Einladung zum Leben, ein Vorgeschmack ewigen Lebens. Auch Petrus wird nicht immer so klare Worte finden wie an dieser Stelle des Evangeliums. Er wird scheitern, Jesus verleugnen und es bitter bereuen. Eine Garantie für Treue gibt es unter uns Menschen leider nicht. Sicherheit ist der Beziehung zwischen Menschen fremd.
Ja, es gibt keine Beziehung ohne Risiko und ohne vorausgehendes Vertrauen. Der amerikanische Philosoph William James verweist darauf, dass uns so manche Wahrheit verborgen bliebe, wenn wir ihr nicht halbwegs entgegen kämen. Dies verdeutlicht der kanadische Philosoph Charles Taylor: Mit einer maximal distanzierten und argwöhnischen Haltung besteht die Gefahr, dass ich auf die Frage „Magst du mich oder nicht?“ die Möglichkeit einer bejahenden Antwort verwirke.
Für das Lebensgeheimnis Christi, die Mitte des christlichen Glaubens, spitzt es der Münsteraner Theologe und Philosoph Klaus Müller zu: Jemand lässt sich prinzipiell nicht darauf ein, dass Gott das irdische Leben eines Menschen gewählt haben könnte, um uns sein Innerstes aufzutun. Ihm oder ihr bliebe diese Mitte genauso prinzipiell verschlossen. Wörtlich sagt Klaus Müller: „Christsein ist nicht selbstverständlich. Sein Besonderes macht aus, dass Gott ein Mensch genügt, um mitzuteilen, was Menschen von ihm wissen müssen.“