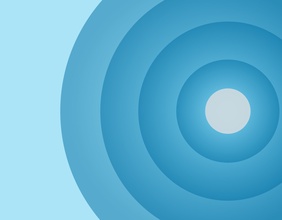Robert Bresson im Filmmuseum
Es gibt im klassischen Kino wenige Filmemacher, die eine derart große Wirkung auf nachfolgende Regisseursgenerationen ausgeübt haben wie der Franzose Robert Bresson. Zu seinen Fans zählen nämlich Größen wie Andrei Tarkovsky, Michael Haneke, Jim Jarmusch oder Aki Kaurismäki.
8. April 2017, 21:58

"L'Argent" (Das Geld), 1983, Robert Bresson
(c) Cinémathèque suisse
Verantwortlich für diese Wirkung waren seine Bildsprache, die mit allem brach, was an den Filmschulen gelehrt wurde, und eine Figurenpsychologie, die alles über den Haufen warf, was man aus Romanen oder Theater gewohnt war. Dabei war es egal, ob er Sagen verfilmte, wie "Lancelot, Ritter der Königin", historische Stoffe wie den "Prozess der Jeanne d'Arc" oder sich den Kleinkriminellen von Paris widmete wie in "Pickpocket". Das Wiener Filmmuseum zeigt jetzt das Gesamtwerk von Robert Bresson.
Kulturjournal, 08.03.2013
Um Robert Bresson auf die Spur zu kommen, empfiehlt es sich, bei seinem großen Feindbild anzufangen. Für ihn hatte das Kino eine falsche Richtung eingeschlagen, als es beschloss, sich am Theater zu orientieren und die Leinwand zur Bühne zu machen. Bresson lehnte das völlig ab und forderte, der Film solle seine eigenen Ausdrucksmittel und Erzählweisen entwickeln. Jede Theatralik, jedes Schauspielen waren Bresson deshalb ein Gräuel, erzählt Filmmuseum-Leiter Alexander Horwath. Die Proben und Dreharbeiten waren deshalb jedes Mal ein langwieriger Kampf Bressons gegen jede Form von eingefahrenen Verhaltensmustern.
Im Zusammenhang mit Bressons Schaffen ist oft von einem Kino der Gesichter die Rede. Er selbst hat auf die Bedeutung der Blicke in seinen Filmen hingewiesen. "Ein einziger Blick kann eine Leidenschaft, einen Mord, einen Krieg auslösen", schreibt er an einer Stelle. Und an anderer Stelle verriet Bresson, dass es ihm nicht um das Erfinden besonderer Filmfiguren gehe, sondern um das Knüpfen neuer Beziehungen zwischen den Menschen untereinander und zwischen Menschen und Dingen. Bresson suchte nach Wahrheiten, so Alexander Horwath, die jenseits des Individuums lagen.
Auf die Spitze getrieben hat Bresson sein Konzept im Jahr 1966, als er im Film "Zum Beispiel Balthasar" einen Esel zum Hauptdarsteller machte. Diese Radikalität und Kompromisslosigkeit führten auch dazu, dass er von jüngeren Regisseuren fast wie ein Guru betrachtet wurde.
"Schöne Bilder" dank Malerei
Der 1901 geborene Bresson war ursprünglich Maler gewesen und hatte seinen ersten Langfilm erst jenseits der Vierzig gedreht. Die Malerei hat auch zu seiner ganz eigenen Bildästhetik beigetragen. "Die Malerei lehrte mich, nicht schöne Bilder zu gestalten, sondern notwendige", meinte Bresson einmal und tatsächlich wird man in seinen Filmen vergeblich nach beeindruckenden Kamerafahrten oder atemberaubenden Landschaftspanoramen suchen. Statt diese groß ins Bild zu rücken, blieb er lieber ganz nah an seinen Figuren. Diese stammten meist aus der Unterschicht, waren Bauern, einfache Arbeiter oder Kleinkriminelle. Was aber nicht hieß, dass Bresson auch seine Schauspieler in diesen Bevölkerungsschichten suchte.
Dennoch ist es oft eine Aura der Weltfremdheit, die Bressons Filme umgibt. Wenn er da in "Lancelot, Ritter der Königin" den Sagenstoff rund um den Heiligen Gral und die Tafelrunde verfilmt, scheint er meilenweit entfernt vom damaligen politischen Geschehen. Doch dieser Schein trügt, so Alexander Horwath.
Fast fünfzig Jahre lang war Bresson als Filmemacher aktiv, wegen der schwierigen Finanzierung konnte er in dieser Zeit aber nur 13 Spielfilme drehen. Die sind jetzt aber alle im Wiener Filmmuseum zu sehen, zusammen mit einigen Dokumentationen, die versuchen, hinter das Phänomen Robert Bresson zu blicken.