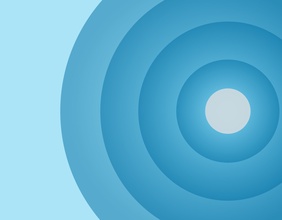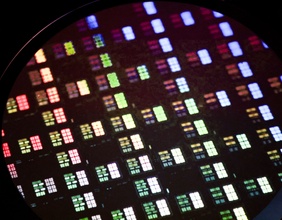Bibelkommentar zu Lukas 23, 35 - 43
„Als der König vor dem Türlein war, klopfte er an und rief: "Lieb Schwesterlein, lass mich herein!" Da ging die Tür auf, und der König trat herein, und da stand ein Mädchen, das war so schön, wie er noch keins gesehen hatte.
8. April 2017, 21:58
Das Mädchen erschrak, als es sah, dass nicht sein Rehlein, sondern ein Mann hereinkam, der eine goldene Krone auf dem Haupt hatte. Aber der König sah es freundlich an, reichte ihm die Hand und sprach: "Willst du mit mir gehen auf mein Schloss und meine liebe Frau sein?"
Diese Szene aus dem Märchen „Brüderchen und Schwesterchen“ der Gebrüder Grimm fiel mir als Kind immer ein, wenn von Königen die Rede war. Ein König, das ist jemand, der mich liebt, aus einer schwierigen Situation rettet und erlöst. Ich liebte dieses Märchen und konnte von diesem König nicht oft genug hören.
So hatte ich auch als Kind keine Schwierigkeiten, wenn Christus als König bezeichnet wurde. Freilich, die Banner und Wimpel, die wir Kinder da bei der Christkönigsprozession tragen mussten, waren mir damals schon körperlich unangenehm. Ich habe immer versucht, diesen Demonstrationen von Macht auszuweichen.
Heute habe ich zu dem Bild des Königs ein weitaus gebrocheneres Verhältnis. Zu sehr ist konkrete Königsmacht in der politischen Geschichte verbunden mit Erinnerungen an Machtmissbrauch, Gewalt, unheiligen Allianzen zwischen Thron und Kirche. Könige waren selten Märchenfiguren, die andere heilen und erlösen.
Die Bibel weiß um diese Ambivalenz der Königsmacht. Das Alte Testament erzählt zwar von Königsmacht, deren Aufgabe darin besteht, Leben zu schützen und zu fördern. Ja, Gott selbst wird König genannt. Zugleich aber zieht sich durch das Alte Testament eine Linie, die kritisch gegenüber jeglicher Herrschaft von Menschen über Menschen ist und diese sogar ablehnt: Wir brauchen keinen König. Nur einer ist der Herr der Geschichte und das ist Gott. Diese Erfahrung wurzelt in der Geschichte des Volkes Israel: ein Volk, das sich aus Sklaven und Armen herausgebildet hat, denen es gelungen ist, sich aus Unterdrückung und Unfreiheit in Ägypten und Mesopotamien zu befreien. Ein Volk, das in dieser Befreiung das Handeln Gottes erkannt hat.
Diese königskritische Tradition steht auch im Hintergrund der Erzählung aus dem Lukasevangelium. Da wird die Königsmacht Jesu beschrieben als eine der Ohnmacht. Jesus ist kein König, wie man ihn sich vorstellt: Er wird deshalb verspottet. Diese Gestalt am Kreuz soll ein König sein? Der kann sich ja nicht einmal selbst helfen.
Jesus am Kreuz irritiert alle menschlichen Vorstellungen von Königsmacht. Das zeigt auch die Reaktion der Spötter: Diese stellt die heimlichen Sehnsüchte nach einem Herrscher bloß, der wie ein Zauberer das Böse in der Welt mit Allmacht ausrotten soll.
Die Königsmacht des Jesus von Nazareth ist anders. Er handelt nicht so, wie wir uns Könige vorstellen: Anschaffen, Befehlen, Herrschen. Jesus ist kein Held. Er kann nur wirken, wenn er gehört und angenommen wird. Jesus offenbart eine andere Art der Macht, die Macht der Liebe: Zuwendung, Geduld, Bereitschaft zur Ohnmacht, Verzicht auf Gewalt. Dieser Weg führt zur Erlösung.

![[HTTPS://CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/BY-SA/3.0/|CC BY-SA 3.0] Strombad Kritzendorf](/i/header/d0/c5/d0c56d0061b7bfa08962245bb6400482e72f9add.jpg)