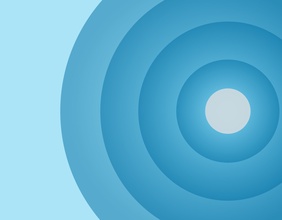Jesse Thoor. Das Werk
Er, der Dichter Jesse Thoor, sang immer wieder, wie in dem späten Gedicht "Rufe zur Nacht", von der Liebe, der Kälte, dem Sterben; berichtete in seinen formstrengen, ausdrucksstarken, ebenso eindringlichen wie einprägsamen, oft von Anrufungen und Exklamationen geprägten Gedichten, in denen sich stets ein starkes Sendungs- und Selbstbewusstsein offenbart, von Natur und Not, harter Realitätserfahrung und religiöser Sehnsucht.
8. April 2017, 21:58
Zitat
Ich, der Dichter Jesse Thoor -
dem Zünglein, Zeh und Ohr
und die Seele fror!
Wenn der März alle Bäche taut,
singe ich wieder laut!
Du meine hohe Braut!
Singe ich dein Herz gesund!
Du meines Sterbens Grund!
Küsse ich deinen Mund!
("Rufe zur Nacht" / Lieder und Rufe 1949 bis 1952)
"Jesse Thoor ist ein großer Solist unter den Dichtern. Seine Poesie ist einzigartig. Sie geht uns alle an", sagt Michael Lentz, der mit dem von ihm herausgegebenen Band mit dem schlichten Titel "Jesse Thoor. Das Werk" zur Wiederentdeckung dieses großartigen Dichters einlädt. "Er ist ein Solitär gewesen, der mit den Psalmen, mit der Bibel als Lebens- und Lesebuch im Rücken, im Kopf, im Geist auch ganz andere Bezüge hatte als eben die zeitgenössische Literatur."
Unstete Existenz
Das Werk von Jesse Thoor, der zu Lebzeiten nur sechs Gedichte in einer Exilzeitschrift und einen schmalen Lyrikband veröffentlichte, ist überschaubar - Gedichte, einige Briefe, ein paar Prosastücke - und weithin unbekannt, auch wenn einst gerühmt von Größen wie Franz Werfel oder Thomas Mann.
Man kann dieses Werk lesen, ohne das Leben des Autors zu kennen, man wird es aber besser verstehen, wenn man von diesem Leben weiß, einer unsicheren, unsteten, abenteuerlichen Existenz, aus dem sich diese Dichtung speiste, die unter dem Pseudonym "Jesse Thoor" entstand - ein Name, zusammengesetzt aus dem des Propheten Jesaja mit dem des germanischen Donnergotts Thor, der die Janusköpfigkeit des Dichters symbolisiert. "Es ist eine Mischung aus einem Mahnenden und einem Poeten. Der mahnende Dichter Jesse Thoor", meint Lentz.
Geboren als Sohn einer aus Österreich stammenden Familie, kam Jesse Thoor als Peter Karl Höfler 1905 in einem Arbeiterbezirk in Berlin zur Welt. Neben dem bäuerlichen Katholizismus seiner Eltern pägte ihn das Elend der Arbeiterklasse. Höfler war ein kleiner, ungemein kräftiger Mensch, der im Handstand eine Treppe hinauflaufen konnte und später keiner Rauferei aus dem Weg ging. Er lernte Feilenhauer, schlug sich als Vertreter durch und zog als Fechtbruder durch Bayern und Österreich, gelangte per Schiff nach Spanien, kam in Rotterdam bei einer Prostituierten unter, ging nach Berlin zurück, verkehrte dort in Künstlerkreisen und wurde Mitglied der Kommunistischen Partei. Von den Nazis verfolgt, flüchtete er 1933 nach Wien und fand Unterkunft bei seiner Tante Josefine Matschl, mit der er bis zu seinem Lebensende auch in Korrespondenz stand.
Das Handwerk des Sonettschreibens
Thoor arbeitete als Tischler, Bildhauer und Silberschmied, konnte in kürzester Zeit sich jedes Handwerk aneignen. In Wien trat Höfler auch als Dichter hervor, er las Gedichte im Radio, vor Freunden und Vereinen. Dabei hatte es ihm vor allem eine Gedichtform angetan: das Sonett. "Wunschsonett", "Schlafsonett", "Irrenhaussonett" heißen seine Texte, "Sonett von der sündhaften Absicht" oder "Sonett von den sieben mageren Jahren".
"Meine These ist, dass er, der verschiedene Handwerksberufe ausgeübt hat, im Sonettschreiben ein Handwerk kennengelernt hat, das ganz bestimmten Regularien entsprechen muss", meint Lentz. "Es steckt eine sehr starke handwerkliche Arbeit dahinter, mit einem starken Sprachbewusstsein. Was man auch an den Varianten sieht... Das Sonett hat eine Form vorgegeben mit zwei Quartettpaaren und zwei Terzetten, die natürlich eine strenge Architektur ist. Wobei es keine Gattung gibt, deren Invarianz so die Varianz ist, d. h., die Sonettform variiert stärker, als es im allgemeinen Bewusstsein ist. Es gibt ja auch reimlose Sonette. Und bei Jesse Thoor habe ich gefunden, dass es Sonette gibt, die überhaupt keinem vorgegebenen Reimschema entsprechen. Da hat er sich viele Freiheiten erlaubt."
Nach dem deutschen Einmarsch floh Höfler nach Brünn und nannte sich ab jetzt Jesse Thoor. Er erhielt Ende 1938 die Einreiseerlaubnis nach London, wurde dort, offenbar von Exilkommunisten, als angeblicher Nazi denunziert und landete im Gefängnis. Nach seiner Freilassung arbeitete er als Gold- und Silberschmied, das Schreiben dagegen fiel ihm zunehmend schwer. Misstrauen, Nervenkrisen, Verfolgungswahn und Heimweh quälten ihn, Jesse Thoor, der immer unzugänglicher wurde, der sich immer mehr in seine eigene, mystische Welt einsponn.
Mit archaischer Kraft
"Er war ein Arbeiter und Kommunist, aber auch genauso stark ein religiös inspirierter Dichter, bis hin zu einem mystischen oder mystizistischen Einschlag", so Lentz. "Er ist ja auch in euphemistischen religiösen Zusammenhängen groß geworden und erzogen worden. Das war eine Grundierung, die er dann beibehalten hat. Ich glaube auch, dass es von mystischen Grunderfahrungen und Grundsätzen durchsetzte Literatur und durchsetztes Leben war, was ihm gewissermaßen auch Halt gegeben hat und was, wenn sein Werk das bezeugt, auch den letzten Halt darstellte."
Die lyrische Sprache von Jesse Thoor ist bildmächtig, volksliedhaft, von archaischer Kraft. Manche fühlen sich an Villon erinnert, an Rimbaud, an Barockdichtung. Was Jesse Thoor tatsächlich gelesen und zum Vorbild genommen haben könnte, bleibt ungewiss. Er war ein Autodidakt, ein handwerklich begnadeter, immer wieder an seinen Sprachgebilden feilender Autor, der sein eigenes Erleben zum Ausdruck brachte und seinen antibürgerlichen Affekt.
Jesse Thoor, der mahnende Dichter, war ein zutiefst moralischer Mensch, der Ungerechtigkeit nicht ertrug, der Erlösung ersehnte. In seinen Gedichten kann das Profane neben dem Sakralen stehen, das Traurig-Melancholische neben dem Groben und Ungeschminkt-Expressiven, der naive neben dem hohen und missionarischen Ton.
Gedichte wie ein Roman
Als Lyriker ist er weder hermetisch, noch experimentell, sondern ein Erzähler, "es gibt Gedichte, die einen ganzen Roman erzählen können", meint Michael Lentz. Jesse Thoor hat ein Faible für das Pointierte, für Pathosformeln und Appelle, er liebt die Aufzählung, die Wiederholung, das Psalmodierende und Litaneihafte.
"Da ist meine These, dass die Litanei, die Psalmen eigentlich sein Lebensbuch waren, was ihm auch die Muster fürs Schreiben geliefert hat - das litaneihafte Schreiben, was er auch ins Sonett eingeführt hat", so Lentz. "Ich kenne keine Sonette, die so litaneihaft orientiert sind, wie seine. Das spricht deutlich eine autobiografische Sprache."
"Die Menschen - ich verstehe sie nicht mehr. Ich bin arm", erklärte Jesse Thoor gegen Ende seines Lebens. Er wurde nur 47 Jahre alt. Im Sommer 1952 starb er, vorübergehend nach Österreich zurückgekehrt, nach einer Bergtour in Osttirol an den Folgen einer Herzthrombose. 1965 erschien eine von seinem Freund Michael Hamburger besorgte, mit einer ausführlichen biografischen Einleitung versehene Werkausgabe, die Grundlage ist dieser neuen, korrigierten und um bisher unveröffentlichte Texte ergänzten Ausgabe, für die Michael Lentz verantwortlich zeichnet, für den der kleine, starke Dichter "einer der bedeutendsten Sonettdichter der deutschsprachigen Literaturgeschichte" ist. Dass er auch die freiere Form beherrschte, beweist sein Gedicht "In der Fremde": eine lakonisch-wehmütige Lebensbilanz.
Zitat
Ist es so auf Erden?
Bin in die Welt gegangen.
Habe mancherlei angefangen.
Aber die Leute lachten.
Auf dem Felde gegraben.
Einen Wagen gezogen.
Ein Zaun gerade gestellt.
Tür und Fenster gestrichen.
Warme Kleider genäht.
Hölzerne Truhe gezimmert.
Feine Stoffe gewoben.
Goldenes Ringlein geschmiedet.
Was soll nun werden?
Werde nach Hause wandern,
und barfuß ankommen.
("In der Fremde" / Lieder und Rufe 1949 bis 1952)
Service
Michael Lentz, "Jesse Thoor. Das Werk", herausgegeben auf Grundlage der von Michael Hamburger besorgten Edition und mit einem Essay von Michael Lentz, Wallstein Verlag