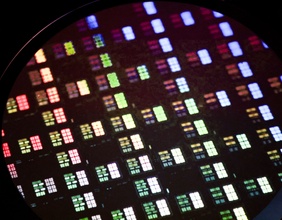Musik als Folter
Die falsche Musik zur falschen Zeit am falschen Ort kann jeden Menschen nerven. Aber dass Musik Folter sein kann, und zwar besonders schwere Folter, das können sich die meisten Menschen schlicht nicht vorstellen. Schon weil seelische Folter im Vergleich zu körperlichen Torturen meist unterschätzt wird.
8. April 2017, 21:58
Der Aufklärung zu diesem Thema dient eine Veranstaltung des Ludwig Boltzmann Instituts für Menschenrechte. Unter dem Titel "Kann Musik Folter sein?" diskutieren drei Expertinnen verschiedener Fachrichtungen.
Kulturjournal, 23.04.2015
Die kanadische Rockband Skinny Puppy hat vor zwei Monaten angekündigt, der US-Regierung eine Rechnung über umgerechnet fast eine halbe Million Euro stellen zu wollen. Und Skinny Puppy erwägen eine Klage - weil ihre Musik im Gefangenenlager Guantanamo eingesetzt wurde, laut Berichten eines ehemaligen Aufsehers. Wie angeblich auch Tracks von Metallica oder erotisch offensive Songs von Britney Spears und Kristina Aguilera. Als extrem laute Nonstop-Beschallung über Tage hinweg ist das als Folter zu werten; hier gepaart mit kultureller Erniedrigung, weil es sich quasi um Musik des Feindes handelt. Weil Musik an sich in so hohem Maß Emotionen anspricht, kann sie auf besonders perfide Arten zur Folter missbraucht werden. Und es ist gerade psychische Folter, die die schlimmsten Dauerschäden bei den Opfern verursacht, erklärt Gerrit Zach vom Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte.
Die UN-Kommission gegen Folter hat schon in den 1990er Jahren zu dem Thema ganz klar Stellung bezogen, weiß die Musikwissenschaftlerin Morag Grant. Die aus Schottland stammende Musikologin hat an der Uni Göttingen sechs Jahre lang die Forschergruppe "Musik, Konflikt und der Staat" geleitet. Bei extrem lauter Dauerbeschallung kann Musikfolter natürlich Gehörschäden hinterlassen; und man kann Leute so singen lassen, dass es physisch extrem leiden macht.
Folter durch Musik hat eine lange traurige Tradition, die insgesamt noch nicht gut genug erforscht ist. Am meisten weiß man bisher über den Einsatz von Musik in NS-Konzentrationslagern. Auch die Häftlingskapellen und -chöre sind in dem Zusammenhang zu nennen. In dem Theaterstück "Der Tod und das Mädchen" von Ariel Dorfmann wird die weibliche Hauptfigur durch Schuberts gleichnamiges Streichquartett jedes Mal retraumatisiert, weil sie zu diesen Klängen mehrfach gefoltert und vergewaltigt wurde.
Überlebende aus dem Bosnienkrieg berichten, dass sie in Gefangenenlagern Cetnik-Lieder singen mussten. Und zwar schön und richtig. Gegenwärtig gibt es etliche Berichte über systematische Musikfolter in russischen Gefangenenlagern und Polizeigefängnissen. Musik muss aber gar nicht gezielt und systematisch eingesetzt werden, um die Wirkung anderer Foltermethoden zu steigern, Musik, die zufällig neben der stattfindenden Folter zu hören ist, reicht, um für immer mit Folter konnotiert zu sein, erklärt Barbara Preitler, Psychologin am Hemayat-Betreuungszentrum für Folter- und Kriegsüberlebende.