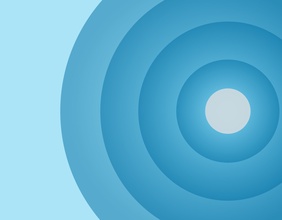Das Hörspiel-Studio im Juni ist dem Thema Kunst gewidmet
Extremkunstarten
Der Hörspiel-Juni - und das ist keine Warnung - wird extrem. Extrem aufregend selbstverständlich. Denn ausgestellt wird Kunst in einem doppelten Sinn. Zum einen sind die vier präsentierten Stücke akustische Kunstwerke im engeren Sinn, zum anderen haben sie mehrheitlich Kunst zum Thema.
8. April 2017, 21:58
Wir sind ihnen ja nicht wirklich gram, verehrte Hörerinnen und Hörer von Ö1, wenn’s Ihnen manchmal zu viel wird. Oder zumindest nicht sehr. Denn an sich wollen wir schon, dass Sie unsere Produktionen hören, dass Sie dran bleiben und nicht gleich aus- oder wegschalten, wenn Sie, wie eine Hörerin einmal schrieb, den Eindruck haben, dass Ö3, FM4 und Ö1 sich irrtümlich auf ein- und dieselbe Frequenz verirrt hätten. Vor allem im Kunstbereich, im Hörspiel-Studio oder im Kunstradio, kann das natürlich vorkommen. Denn Ö1 ist nicht nur ein journalistisches Medium, eines, in dem Themen und Sachverhalte möglichst "publikumsgerecht" aufgearbeitet werden, nein, Ö1 ist auch eine Plattform für aktuelle, zeitgenössische und radikale Kunst.
Der Hörspiel-Juni - und das ist keine Warnung - wird extrem. Extrem aufregend selbstverständlich. Denn ausgestellt wird Kunst in einem doppelten Sinn. Zum einen sind die vier Stücke, die wir Ihnen jeweils am Dienstagabend im Hörspiel-Studio präsentieren, akustische Kunstwerke im engeren Sinn, zum anderen haben sie mehrheitlich Kunst zum Thema. Da ist zunächst einmal Martti Mauri. Nie gehört? Kein Wunder. Es gibt ihn nämlich nicht. Die deutsche Schriftstellerin und "Audiografin" Gabi Schaffner hat den finnischen Motorenmusiker einfach erfunden. Mitsamt Biografie und Werkverzeichnis. Martti Mauri jedenfalls - er kam passenderweise bereits 2003 bei einem Autounfall ums Leben - liebte Motoren. Und machte aus Motorengeräuschen Musik. Sein berühmtestes Werk, das titelgebende Stück Otto Mötö, komponierte er aus Anlass des 100. Geburtstages des Otto-Motors. Gabi Schaffner hat für ihr fiktives Portrait eine dokumentarische Form gewählt. Mockumentary nennt man sowas auf Englisch. Eine Form, in der nicht nur ein fiktiver Fall dokumentiert wird, gleichzeitig wird auch der Wahrheitsanspruch gängiger journalistischer Formate in Frage gestellt. Wenn etwas klingt wie eine Doku ist es in jedem Fall eine solche. Formal gesehen. Die Wahrheit ist schließlich eine Tochter der Form. Und darüber darf sich das Hörspiel, die freieste Form des Radios, gelegentlich mokieren.
Keineswegs erfunden hingegen ist das Marbacher Literaturmuseum der Moderne, genannt LiMo. Dort werden Objekte und Dokumente der jüngeren Literaturgeschichte ausgestellt. Peter Handkes Maultrommel, eine Liste mit Einrichtungsgegenständen aus der Wohnung von Gottfried Benn, eine Schallplattenaufnahme mit Hugo von Hofmannsthal. Andreas Ammer und FM Einheit haben sich nun nichts Geringeres vorgenommen, als die Geschichte der modernen Literatur zu vertonen. In ihrem Stück "LiMo on Tape" machen sie sich ebenso lustvoll wie radikal über Ernst Jünger, Kurt Schwitters oder Martin Heidegger her. Und bringen mit brachialen Mitteln ein ganzes Museum zu klingen.
Ebenfalls mit Versatzstücken aus der Realität arbeiten die österreichische Schriftstellerin Natascha Gangl und der kolumbianische Musiker und Komponist Sergio Vásquez Carrillo.
Sie haben das Seniorenwohnheim Schloss Neuteufenbach in der Steiermark besucht und lange Gespräche mit dessen Bewohner/innen geführt. Das hätte ein berührendes Radiofeature werden können. Ist es aber nicht. Natascha Gangl hat die Gespräche aufgezeichnet, poetisch verdichtet und zur Textgrundlage einer Komposition ihres kolumbianischen Künstlerkollegen gemacht. Das so entstandene Hörstück "Meine Träume erzähle ich ihnen nicht"verzichtet auf jede Form von kitschigem Pathos und Mitgefühl. Kunst, so lautet das Credo der beiden, ist eine Übersetzungsleistung. Das spiegelt sich auch im Namen der engagierten Künstlertruppe. Gemeinsam nennen sich Natascha Gangl und Sergio Vásquez Carrillo "Die Transmissionare".
Das vierte Hörspiel-Studio im Juni schließlich ist einem gewidmet, der buchstäblich keine Grenzen kannte - dem Performancekünstler, Maler, Bildhauer und Fotografen Martin Kippenberger. Einem, der seine Kunst lebte und der daran auch zerbrach. Martin Kippenberger war 44 Jahre alt, als er im März 1997 in Wien verstarb. Er erzählte gerne schlechte Witze, reimte holprig und gab gern Nonsenstexte zum Besten. Diese wiederum haben Oliver Augst und Rüdiger Carl, mit Unterstützung des Musikers Sven-Ake Johansson, zu einem Hörspiel collagiert. Selbstverständlich wusste Martin Kippenberger jeden Augenblick was er tat. Gute Texte gibt es glücklicherweise viele. Kaum jemand aber hat mit schlechten Texten so gute Kunst gemacht.