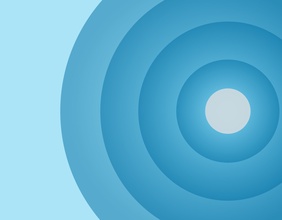Porträt Jaron Lanier
Der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels geht heuer an den US-amerikanischen Informatiker Jaron Lanier. Während in den letzten Jahren regierungskritische Schriftsteller aus China, Algerien und Weißrussland ausgezeichnet wurden, geht der Preis damit erstmals an einen Repräsentanten des digitalen Zeitalters.
8. April 2017, 21:58

(c) ORF/URSULA HUMMEL-BERGER
Kulturjournal, 95.06.2014
Der 54-jährige Lanier sieht noch immer aus wie ein Nerd, der die meiste Zeit in seinem mit Computern vollgestopften Keller verbringt. Blass, mit hüftlangen Dreadlocks und einem ungepflegten Bart und schwerfällig, als würde er sich vornehmlich von Fast-Food ernähren. Seine Biografie unterstreicht zusätzlich noch den Mythos des Computergenies: Schulabbruch mit 15, zum Mathematikstudium wird er aber wegen besonderer Leistungen dennoch zugelassen, mit 25 gründet er gemeinsam mit einem Freund sein erstes Software-Unternehmen.
Jaron Lanier: "Ich habe nichts gegen Erfolg. Ich bin im Silicon Valley sozialisiert worden und bewundere Menschen, die mit innovativen Ideen Geld machen. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel die Fotoplattform Instagramm hernehmen, dann haben wir hier ein Unternehmen mit 13 Angestellten vor uns, das eine Milliarde Dollar wert ist. Das geht aber nur, weil es Millionen User gibt, die ihre Fotos unentgeltlich zur Verfügung stellen."
Man hört es schon heraus. Aus dem Internet-Pionier und einst glühenden Verfechter der Gratis-Kultur im Netz, ist einer ihrer schärfsten Kritiker geworden. Dass die freie Verfügbarkeit von Informationen in eine Sackgasse führe, so Lanier, ließe sich mit einer einfachen Milchmädchenrechnung belegen: "Umso mehr Automatisierung es gibt, umso mehr wird unsere Wirtschaft von Informationen abhängig. Wenn Information aber gratis ist, bedeutet das damit zwangsläufig, dass die Wirtschaft schrumpfen wird."
Lanier hat einst den Begriff der "Virtuellen Realität" geprägt. So viele Stunden wir aber auch täglich im Internet verbringen, dürfen wir nicht vergessen, dass am Ende des Tages die Wirklichkeit an die Tür klopft: "Vorteile wie freie Serviceleistungen helfen dir nicht dabei, deine Kinder zu ernähren oder deine Miete zu bezahlen. Deshalb braucht es auch in der Internet-Gesellschaft ganz herkömmliche Formen der Belohnung und Bezahlung."
Der gebürtige New Yorker lebt mittlerweile in Berkeley, wo er an der Universität unterrichtet und sich den Ruf eines Internet-Philosophen erworben hat. Zwei Bücher hat er schon geschrieben: 2010 das Manifest "You are not a gadget", also "Du bist keine Apparatur". Darin kritisierte er ein Phänomen, das er "Digitalen Maoismus" nannte, der Glaube nämlich, dass ein Kollektiv Intelligenz, Ideen und Meinungen hervorbringen könne, die denen des Individuums überlegen seien.
Letztes Jahr brachte er dann "Who owns the future?" heraus, das diesen Frühling unter dem Titel "Wem gehört die Zukunft?" auf Deutsch erschienen ist. Das Buch ist unter anderem ein Abgesang auf den Irrglauben, das Internet hätte die Macht, die Gesellschaft zu demokratisieren. Jaron Lanier: "Wer innerhalb eines freien Netzes den leistungsfähigsten Computer hat, kann damit alle anderen beherrschen. Er wird zum Spion, zum großen Datenräuber, der alle anderen User zu seinem Vorteil ausbeuten kann. Und ganz egal, ob diese Datenräuber jetzt Geheimdienste sind oder Wirtschaftsspekulanten, die Waren absichtlich knapp halten, oder bekannte Unternehmen wie Google, Facebook oder Microsoft, das Spiel ist das gleiche. Und weil dieses Spiel nicht nachhaltig ist, müssen wir es verändern."
Jaron Laniers Vorteil liegt darin, das Internet aus beiden Blickwinkeln kennengelernt zu haben: aus der Sicht der Großunternehmen in Silicon Valley, für die er lange Jahre gearbeitet hat, und aus der Sicht des einfachen Users. Und seine Stärke liegt darin, seine Thesen mit schimmernden und polemischen Begriffen auffetten zu können. Die großen Webunternehmen bezeichnet er da etwa als Sirenen-Server, die ihre Benutzer verführen und ausnehmen.
Jaron Lanier: "In jeder Software und jeder App, die wir aus dem Internet herunterladen können, steckt künstliche Intelligenz. Die konnte aber nur entstehen, indem Menschen entrechtet und anonymisiert wurden. Von Menschen generierte Daten wurden einfach wiederverwendet. Überspitzt gesagt reduzieren wir deshalb, jedes Mal, wenn wir Facebook benützen, unsere zukünftigen Berufsaussichten."
Nicht verschwiegen werden soll, dass Jaron Lanier ein leidenschaftlicher Musiker ist. Einmal hat er im Vorprogramm von Bob Dylan gespielt, außerdem sammelt er seltene Musikinstrumente aus aller Welt. Ob es ihm gelingt, die Sirenen-Server zu übertönen, bleibt abzuwarten. Den mit 25.000 Euro dotierten Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommt er jedenfalls zum Abschluss der heurigen Frankfurter Buchmesse am 12. Oktober verliehen.