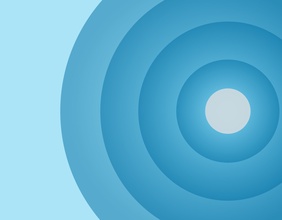Bibelkommentar Lukas 1, 39 – 56
Es ist eine ebenso natürliche wie besondere Situation, in der die beiden Frauen aufeinandertreffen. Sie sind miteinander verwandt, beide zum ersten Mal schwanger. Elisabeth, die ältere, ist schon betagt. Unfruchtbar sei sie, so hat es geheißen.
8. April 2017, 21:58
Im alten Israel bedeutet das mehr als die Aussicht, ein Leben ohne Kinder zu verbringen. Es ist ein soziales Stigma. Die unfruchtbare Frau kommt dem Auftrag Gottes, sich fortzupflanzen und zu vermehren, nicht nach. Der Segen Gottes ruht nicht auf ihr, und bei wem dies derart offensichtlich ist, der genießt auch gesellschaftlich kein Ansehen. Elisabeth gilt als wert- und nutzlos. Sie ist wie eine Tote unter den Lebendigen. Doch nun ist sie schwanger, guter Hoffnung, zum Leben erwacht.
Als Maria sie besuchen kommt, ist Elisabeth im letzten Drittel der Schwangerschaft. Der Alltag dürfte zu diesem Zeitpunkt schon beschwerlich sein. Elisabeth kommt außer Atem, die Beine werden schwer. Sie muss sich schonen, um das Risiko einer Fehlgeburt zu vermeiden. Das alles macht die Geschäftigkeit des Alltags langsamer – auch weniger selbstbestimmt. Die Schwangere ist auf Unterstützung angewiesen, und Elisabeth wird froh sein, dass ihre Verwandte nun da ist. Drei Monate, so heißt es, verbringen die Frauen miteinander. Sie helfen sich gegenseitig, tauschen sich aus, suchen nach einer geschützten Situation für das heranwachsende Leben. Es ist das Faszinierende an diesem Text, dass in diese Zeit gegenseitiger Fürsorge, in der die Geschäftigkeit des Alltags ruhiger wird und das Leben sich an neue Umstände anpassen muss, Gottes Wirken spürbar wird.
Maria singt, als sie zu Elisabeth kommt, das Magnifikat, und es ist wie ein prophetischer Paukenschlag inmitten der friedlich-freudigen Szenerie. Gott lässt sie groß sein – sie die „Sklavin Gottes“. Das ist die Wendung, die der Text gebraucht. Maria ist nicht einfach eine niedrige Magd angesichts der Größe des Herrn, wie es unsere Bibelübersetzungen nahe legen. Wie Elisabeth ist auch sie eine durch Menschen erniedrigte – erniedrigt als Arme, als Frau, als Vertreterin eines Volkes, das von den Römern unterdrückt ist. In der Erfahrung heranwachsenden Lebens bündelt der Text familiäre Situation, gesellschaftlichen Status und politische Situation eines Volkes. Er nutzt den Neuaufbruch, den ein ungeborenes Leben bedeutet, um den Neuaufbruch, den Gott an den Menschen bewirkt, spürbar zu machen.
Als die Frauen aufeinandertreffen, hüpft in Elisabeths Bauch das Kind, das später der Prophet Johannes der Täufer sein wird. Die Kindesbewegungen, die der Mutter schon so deutlich zeigen, dass da jemand anderes ist als sie selbst, werden für Elisabeth zum prophetischen Zeichen. All das Gute, das sie selbst durch die Schwangerschaft erfährt, und ebenso das Gute, das sie ihrem Kind für seine Zukunft wünscht, soll der ganzen Welt zuteil werden. Diese Hoffnungen, die im besten Fall unsere Schwangerschaften bis heute begleiten, kündigen hier den Messias an. Marias Kind wird zum Heilsbringer für das ganze Volk und alle Menschen werden, - das ist die zentrale Botschaft aller Texte des Neuen Testaments. Und die Frauen in froher Erwartung sind die ersten, die das erkennen. Es ist eine fragile Situation, so eine Schwangerschaft – zwischen Altem und Neuem, zwischen Leben und Tod. In dieser Fragilität des Daseins begegnet Gott.