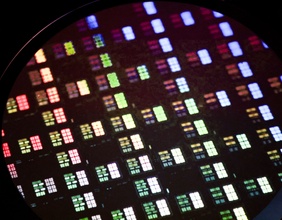"Das Tagebuch der Anne Frank" im Kino
Es ist ein Stück Weltliteratur und auch Teil des Weltdokumentenerbes der UNESCO: das Tagebuch der Anne Frank. In über 70 Sprachen wurde es übersetzt, es gibt zahlreiche Bühnenfassungen, Hörspiele, Opern und Verfilmungen. Nun hat sich der bayerische Regisseur Hans Steinbichler des Stoffes angenommen.
8. April 2017, 21:58
Morgenjournal, 2.3.2016
Es ist ein besonderes Geschenk, das Anne Frank zu ihrem 13. Geburtstag am 12. Juni 1942 bekommt - ein Tagebuch, das für die kommenden zwei Jahre zu ihrem wichtigsten und überlebensnotwendigen Bezugspunkt werden sollte: Kurz nachdem sie das Tagebuch geschenkt bekommt, beginnen in Amsterdam sogenannte Aufrufe und Juden müssen sich an einem bestimmten Tag an einem bestimmten Ort einfinden. Als Annes Schwester Margot einen solchen Aufruf erhält, entscheidet sich die Familie unterzutauchen und bezieht das sogenannte Hinterhaus in der Prinsengracht 263 - ein versteckter Anbau des Geschäfts von Otto Frank.
Kammerspiel in Brauntönen
Regisseur Hans Steinbichler inszeniert das Tagebuch der Anne Frank als Kammerspiel in Pastell- und Brauntönen. Bis auf wenige Ausnahmen spielt sich die gesamte Handlung im Hinterhaus ab. Wenig mehr als 50 Quadratmeter stehen den Bewohnern dort zur Verfügung. Es gibt kaum Licht und untertags darf die Toilette nicht benutzt werden. Dennoch trotzen die Untergetauchten ihrer tristen Lage mit lebensbejahendem Humor.
Anne Frank ist hier nicht nur die frühreife, willensstarke und scharfsinnige Beobachterin und Chronistin ihrer Umwelt. Anne Frank ist hier auch ein ganz normaler Jugendlicher, voller Zweifel und Ängste. Genau das wollte er auch erreichen, so Regisseur Hans Steinbichler. Nicht an einer Heldenfigur zu meißeln, sondern Anne Frank als ein Mädchen von vielen zu zeichnen.
Tagträume, Schwärmerei und Enttäuschung
Vor allem die Liebesgeschichte zwischen Anne und Peter van Pels wird im Film zum Symbol von Normalität inmitten des Wahnsinns. Anne Frank darf hier ein typischer Teenager sein, der zwischen Tagträumen, Schwärmerei und Enttäuschung pendelt.
Dem Film gelingt es, die Ikone Anne Frank zu erden und das Intime, das Menschliche, die Streitereien und die kurzen Momente des Glücks im Hinterhaus einzufangen. Gerade diese Alltäglichkeit ist es, die die abgrundtiefen Schrecken des Holocausts wuchtiger und unmittelbarer wirken lässt als ein großformatiges Schlachtengemälde.