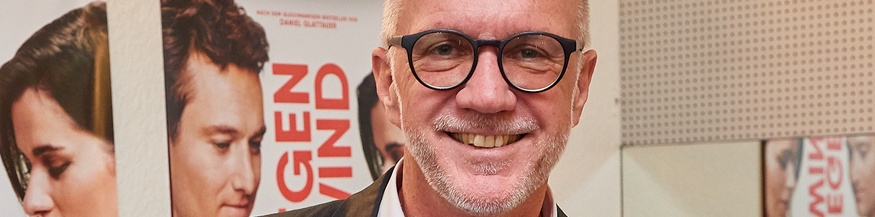Die neunte Berlin Biennale startet
Billige Mieten und Freiräume, das sind die beiden zentralen Faktoren, die Berlin nach dem Fall der Mauer zur Künstlerhauptstadt Europas gemacht haben. In jeder Baulücke entsteht Kunst, in jedem Hinterhof befindet sich ein Off-Space, so lautete lange Zeit die Mär.
26. April 2017, 12:23
1998 fand die Berlin Biennale zum ersten Mal statt und zwar in den Räumlichkeiten einer ehemaligen Margarinefabrik in Berlin Mitte. Gestern eröffnete die neunte Ausgabe. Sie wurde von einem vierköpfigen Kreativteam aus New York kuratiert, das mit gängigen Berlin-Klischees aufräumt.

Die 9. Berlin Biennale präsentiert ein "Best of" der Post-Internet-Art.
ORF/CHRISTINE SCHEUCHER
MIttagsjournal, 4.6.2016
Service
Berlin Biennale
4. Juni bis 18. September 2016
Inmitten des Ruinenchic entstand sie also die neue, die aufregende Kunst, damals in den 1990er Jahren. Bis heute zehrt Berlin von seinem Ruf, Europas Kreativlabor zu sein. Obwohl die letzten Baulücken im Herzen der Stadt mittlerweile geschlossen und die Mieten längst nicht mehr so billig sind. Zeit also, die Klischees hinter sich zu lassen. Und genau das tut das 4köpfige New Yorker Kuratoren-Kollektiv DIS, das in diesem Jahr für die Berlin Biennale verantwortlich zeichnet. Die Besucher und Besucherinnen der Großausstellung werden nicht durch sinistre Hinterhöfe und abgerockte Fabriksetagen gejagt, sondern man lädt sie sozusagen ein, ins Zentrum der Macht vorzudringen. Einer der Hauptaustellungsorte ist die Akademie der Künste, vis a vis befindet sich das Brandenburger Tor, einen Steinwurf entfernt der Reichstag. Als Kollektiv aus New York, sagt Solomon Chase, von DIS habe man schließlich einen touristischen Blick auf die Stadt. Den stelle man ungeniert aus. „Wie wollten nicht so tun, als müssten wir den Berlinern Berlin zeigen“, so Solomon Chase, einer der Kuratoren der 9. Berlin Biennale. Sie steht im Zeichen der so genannten Post-Internet-Art. Kunst gemacht von so genannten Digital Natives, Künstlern und Künstlerinnen also, die mit dem Internet aufgewachsen sind, es zu ihrer Leinwand und oder Projektionsfläche machen. Unter ihnen der Neuseeländer Simon Denny, der bei der letzten Kunst-Biennale in Venedig sein Heimatland vertreten.
Im ehemaligen Staatsratsgebäude der DDR, heute Sitz einer Privatuniversität, hat Simon Denny mehrere Räume gestaltet. Auf den ersten Blick könnte man meinen, man befinde sich auf einer Business-Messe. Firmenlogos, Kojen, in denen Unternehmen ihre Produkte präsentieren. Die glatten Designoberflächen der modernen Unternehmenswelt wirken im Kontext einer Kunstausstellung deplatziert. Doch darum geht es Simon Denny. Er mache daraus eine Skulptur, sagt er.
Die Macht der digitalen Bilder
Und auch sie gehört zu jenen Künstlerinnen, die momentan auf internationalen Ausstellungen Furore machen. Im letzten Jahr bespielte die Videokünstlerin Hito Steyerl den deutschen Pavillon auf der Biennale in Venedig, jetzt hat sie eine Arbeit für die Berlin Biennale entwickelt. Wie immer verhandelt Steyerl brandaktuelle Themen in ihren futuristisch anmutenden Bilderwelten. Diesmal geht es um die Schnittflächen zwischen Hightech-Kreativindustrie und realen militärischen Ereignissen. Ausgangspunkt ist das Interview mit einem ukrainischen Kreativunternehmer, dessen Firma Renderings, also Animationen, entwickelt: Virtuelle Rundgänge durch Luxusimmobilien, oder Shopping Malls, aber auch militärische Simulationen.
"Das ist die neue Version von Video und Film. Video und Film wird zunehmend ersetzt, oder zumindest ergänzt durch 3D-Renderings", so Hito Steyerl, deren Arbeit "The Tower" aktuell bei der Berlin Biennale zu sehen. In diesem Jahr eine Art Best-Of der Post-Internet-Art. Zu sehen ist Kunst, die garantiert zeitgeistig ist, aber streckenweise ein bisschen blutleer.