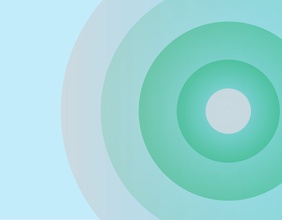Bibelessay zu Galater 3, 26 – 29
Ein alter Traum der Menschheit. In Ländern, die sich für modern halten, wird um seine Verwirklichung erfolgreich gerungen. Das Völkerrecht hat sich ihm angenähert. So steht im Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte: „Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren.“
8. April 2017, 21:58
Dass es solche Rechtsformeln braucht zeigt, dass an zu vielen Orten der Welt dieses Recht nicht geachtet wird. Es wäre sonst nicht nötig gewesen zu betonen, wie es im Artikel 2 weiter heißt: „Jeder hat Anspruch auf die in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Überzeugung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand.“
Der Text aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinden in Galatien geht davon aus, dass auch in der damaligen Zeit solche Unterschiede gemacht wurden, nach Rasse, Stand und Geschlecht.
Drei schwerwiegende Diskriminierungen zählt Paulus auf: Da ist zunächst die rassistische Diskriminierung – in seinem Beispiel zwischen Juden und Griechen. Dann folgt die Diskriminierung zwischen Arm und Reich, genauer zwischen den reichen Freien und den armgehaltenen Sklaven. Soll man sie die ökonomistische, die kapitalistische Diskriminierung nennen? Und schließlich die sexistische Diskriminierung je nach Geschlecht, zwischen Männern und Frauen, Heteros und Homos.
Diese drei Diskriminierungen haben die Menschheitsgeschichte geprägt. Der Rassismus des Nationalsozialismus mündete im Holocaust, der Vernichtung von Millionen von Juden. Die Wirtschaftsweise des ungezügelten Kapitalismus tötet trotz partieller Fortschritte viele Menschen in den armgehaltenen Regionen der Einen Welt: „Diese Wirtschaft tötet“, schrieb Papst Franziskus zum Ärger vieler Mächtiger zumal in der US-amerikanischen Finanzwelt. Menschen mit gleichgeschlechtlicher sexueller Orientierung werden bis heute in manchen Ländern der Welt verfolgt.
Angesichts dieser Diskriminierungen entwirft Paulus seine gläubige Vision, die in der Sache der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte voll entspricht. Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, Sklaven und Freie, Männer und Frauen – eins geworden sind sie „in Christus“. Die große Bischofsversammlung in der katholischen Kirche, das Zweite Vatikanische Konzil der Jahre 1962 - 1965, hat diese Vision aufgegriffen. Im Lehrschreiben über die Kirche heißt es: „Auf Grund der Wiedergeburt in Jesus Christus Herrschaft unter allen Gläubigen eine wahrhafte Gleichheit an Würde und Berufung“. Die Gleichheit hebt nicht die Unterschiede – modern gesagt die diverity – auf. Aber sie beendet die Diskriminierungen.
Warum wohl der Apostel Paulus eine derart politische Aussage an die frommen Christengemeinden in Galatien schreibt? Weil es offenbar auch in diesen Diskriminierungen gegeben hat. Ein dunkles Thema, das den christlichen Kirchen und anderen Weltreligionen bis heute treu geblieben ist.
Allerdings gab es in den christlichen Kirchen eine beachtliche, wenngleich viel zu langsame Entwicklung, die längst noch nicht abgeschlossen ist. Der Innsbrucker Theologe Raymund Schwager hat das einmal so erklärt:
An der Abschaffung der ersten, der rassistischen Diskriminierung hat das Apostelkonzil erfolgreich gearbeitet. Damals wurde beschlossen, dass Juden und Griechen, die für die Heiden stehen, gleichgestellt wurden, wenn es um die Aufnahme in die Kirche und die Spielregeln des Lebens ging.
Um die zweite, die ökonomistische Diskriminierung aufzuheben, brauchte die Kirche nahezu 1500 Jahre. Bei der Eroberung Amerikas hielten die christlichen Konquistatoren die einheimischen Indios selbstverständlich für Sklaven. Erst der große Bischof Bartolome de las Casas erreichte nach einer langen persönlichen Bekehrungsgeschichte bei Papst Paul III. ein Verbot der Sklaverei.
Und die dritte schmerzliche Diskriminierung, die sexistische? „Daran arbeiten wir noch“, so der leider viel zu früh verstorbene Innsbrucker Theologe.