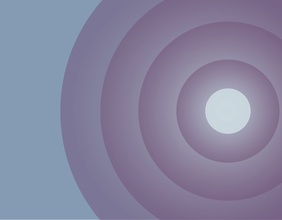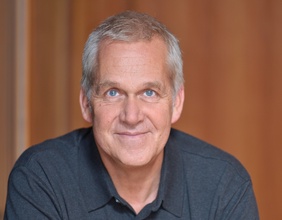Dimensionen - die Welt der Wissenschaft
1. Die erstaunlichen kognitiven Leistungen der Kakadus
2. Keimfrei dank Farbstoffen
3. Der ideale Arbeitsplatz? Von der Fabrikhalle zur Bürolandschaft
4. Germanophobie: ein neues Phänomen in der Schweiz
Redaktion und Moderation: Franz Tomandl
16. August 2013, 19:05
1. Die erstaunlichen kognitiven Leistungen der Kakadus
Wie nehmen Tiere ihre Umwelt war? Können sie die Beziehung von Objekten verstehen und sich zu Nutze machen? Und wie ist im Laufe der Evolution intelligentes Denken und Handeln entstanden? Mit diesen Fragen beschäftigt sich die Kognitionsbiologie. Wer dabei nur an Schimpansen und Orang Utans denkt, hat weit gefehlt: Auch Vögel erreichen kognitive Leistungen, die bei Menschenkindern erst im Alter von vier Jahren beobachtet werden. Spitzenreiter sind dabei die Kakadus: Weiß gefiederte Papageienvögel, denen man ihre Intelligenz buchstäblich von den Augen ablesen kann. Eine Kognitionsbiologin der Universität Wien untersucht diese Fähigkeiten wissenschaftlich: Sie lässt die Vögel Schlösser knacken und spielt mit ihnen Hütchenspiele. Mit Alice Auersperg, Kognitionsbiologin Universität Wien und Kakadus. Autor: Wolfgang Däuble.
2. Keimfrei dank Farbstoffen
Immer mehr machen den Ärzten Keime zu schaffen, gegen die kein Kraut gewachsen ist. Multiresistente Bakterien - gegen die wirken auch Antibiotika nicht mehr. Experten sprechen schon von einer tickenden Zeitbombe in der Medizin. Deshalb sind andere Verfahren gefragt, um Mikroorganismen zu bekämpfen. Zum Beispiel die Desinfektion in Krankenhäusern oder bei der Verarbeitung von Lebensmitteln. Dazu haben Regensburger Forscher einen neuen Ansatz entwickelt. Mit Anja Eichner, Wolfgang Bäumler, Abt. Dermatologie, Universitätsklinikum Regensburg. Autor: Hellmuth Nordwig
3. Der ideale Arbeitsplatz? Von der Fabrikhalle zur Bürolandschaft.
Die Arbeit hat sich in den letzten 50 Jahren massiv verändert. Nicht materielle Produkte, sondern Wissen, Kommunikation und Kreativität stehen für die meisten Menschen am Ende des Arbeitsprozesses. Die Architektur hat diese Veränderungen begleitet. Sie hat versucht - je nach dem von wem die baulichen Konzepte stammten - die bestmöglichen räumlichen Lösungen für die Arbeitenden zu finden oder aber Kosteneffizienz und Gewinn in den Mittelpunkt gestellt. Der Architekt und Designforscher Andreas Rumpfhuber hat in seinem Buch "Architektur immaterieller Arbeit" untersucht, in wie weit sich die Produktionsräume der Wissens- und Dienstleistungsgesellschaft verändert haben. Ideen der räumlichen Organisation, die in den 1960er Jahren entwickelt wurden, scheinen dabei bis heute die Arbeitswelt zu bestimmen. Mit Andreas Rumpfhuber, Autor. Gestaltung: Marlene Nowotny.
Buchtipp: Andreas Rumpfhuber: "Architektur immaterieller Arbeit", Turia+ Kant
4. Germanophobie: ein neues Sozialphänomen in der Schweiz
"Seien Sie doch etwas weniger Deutsch" - mit diesem Slogan wirbt ein privates Coaching-Unternehmen in den Zürcher Öffis um Kunden. Die Zielgruppe sind Migrantinnen und Migranten aus Deutschland. Wie in Österreich bilden die Deutschen in der Schweiz die größte Immigrantengruppe. Doch während nach Österreich besonders viele deutsche Studierende kommen, handelt es sich bei jenen, die in die Schweiz gehen, meist um hoch gebildete Arbeitsmigrantinnen und Migranten. Sie bekommen alltäglich die Ressentiments der Schweizer Bevölkerung zu spüren. Ein Schweizer Politologe hat untersucht, wie es in Zürich um die Xenophobie gegenüber Deutschen bestellt ist und kommt zu dem Ergebnis, dass Fremdenfeindlichkeit keine Frage des Bildungsniveaus ist. Mit Marc Helbling, Politologe, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Autorin: Tanja Malle.