Das Scheitern der ärmsten Länder
Die unterste Milliarde
In rund fünfzig Ländern befindet sich die Wirtschaft seit den 1990er Jahren im freien Fall. Hier leben die ärmsten Menschen der Erde. Wie es zu dieser krassen Armut gekommen ist und was man gegen sie tun kann, erläutert Paul Collier in seinem Buch.
8. April 2017, 21:58
Die Dritte Welt sei deutlich kleiner geworden, erklärt der Ökonomieprofessor Paul Collier, denn viele sogenannte Entwicklungsländer sind nicht mehr wirklich arm, sondern entwickeln sich erstaunlich schnell. Die eigentliche Herausforderung bestehe darin, einer Gruppe von Ländern am untersten Rand zu helfen, die immer mehr zurückfällt: südostasiatische und vor allem afrikanische Staaten.
Die Länder, die heute das Schlusslicht bilden, sind nicht nur die allerärmsten, sie haben auch kein Wirtschaftswachstum und weichen damit vom Entwicklungsmuster der meisten anderen Länder ab. Mit dem steilen Wirtschaftswachstum ehemals armer Staaten wie Indien und China wurde das globale Bild der Armut verwischt und divergierende Entwicklungen übertüncht. Sicher, damit es einigen Ländern vergleichsweise besser ging, musste es anderen vergleichsweise schlechter gehen. Aber der Niedergang der Länder, die heute das Schlusslicht bilden, übersteigt jede Verhältnismäßigkeit.
Fehlendes Wirtschaftswachstum
Fehlen würde das Wachstum, so Paul Collier. Wirtschaftswachstum sei zwar kein Wundermittel, würde also nicht automatisch Armut beseitigen, aber fehlendes Wirtschaftswachstum lässt den Kuchen, von dem alle etwas haben wollen, nicht größer werden. Und das führe unweigerlich zu Konflikten, wie etwa Bürgerkriegen.
Die Wahrscheinlichkeit eines Bürgerkriegs ist in Ländern mit niedrigem Pro-Kopf-Einkommen sehr hoch. Und wenn es sinkt, fand Paul Collier heraus, dann steigt das Bürgerkriegsrisiko auf das Doppelte. Auch die Abhängigkeit von Rohstoffexporten wie Erdöl oder Diamanten erhöht das Bürgerkriegsrisiko beträchtlich, meint Paul Collier.
Desaströs seien Bürgerkriege nicht nur aufgrund des Verlustes an Arbeitskräften und den hohen staatlichen Ausgaben. Wirklich teuer würde es erst nach dem Krieg. Die Folgekosten machen etwa die Hälfte der Gesamtkosten aus.
Verschleuderte Ressourcen
Nach der Konfliktfalle geht der Leiter des Instituts of African Economies an der Oxford University auf die sogenannte Ressourcenfalle ein. Seiner Meinung nach sind natürliche Ressourcen wie Erdöl oder Diamanten ein Fluch für die Gesellschaft: "Die Geschichte hat gezeigt, dass viele Länder, die Erlöse durch natürliche Ressourcen erzielen - wie etwa Ölfunde in Nigeria in den 1970er und 80er Jahren - kurze Booms erleben, aber daraus keine nachhaltige Entwicklung schaffen", so Collier im Gespräch. "Nigeria ist heute ärmer als es vor dem Fund des Öls war. Das muss überhaupt nicht so sein."
Als Beispiel zieht Collier Botswana heran: "Da wurden Diamanten gefunden und Botswana wurde nicht nur das am schnellsten wachsende Land Afrikas, sondern der Welt, weil die Diamantenerlöse dazu genutzt wurden, nachhaltige Entwicklung zu betreiben."
Die Politik würde falsch handeln, etwa bei der Vergabe der Rechte des Abbaus der natürlichen Ressourcen. Statt einer Auktion, bei der der Höchstbietende die Rechte erwirbt, wird viel zu oft Misswirtschaft betrieben. Außerdem bringt der Ressourcenreichtum oftmals mit sich, dass die Bevölkerung nicht mehr besteuert wird. Dadurch wird die Frage, wie mit den Ressourcen umgegangen wird, kaum von der Bevölkerung hinterfragt. Eigentlich müssten, so Paul Collier, die Erdöl- oder Diamantenverkäufe besteuert und ein Teil dieser Steuereinnahmen gespart werden. Leider passiere das viel zu selten, meint Collier.
Genmanipulierte Lebensmittel für Afrika
Die USA habe die Verrücktheit begangen, auf Biotreibstoffe zu setzen. Eine Tankladung eines SUVs entspräche dem, was ein Afrikaner ein Jahr lang isst. Dieses Missverhältnis müsse rückgängig gemacht werden. Und Europas große Verrücktheit sei das Verbot von genmanipuliertem Saatgut, denn das benötige Afrika ganz dringend und es täte Afrika gut.
"Weil Europa genmanipuliertes Essen verboten hat, hat es Afrika auch verboten, weil die afrikanischen Regierungen Angst davor haben, nie wieder Essen nach Europa exportieren zu können, wenn sie genmanipulierte Samen verwenden", erklärt Collier. "Afrika braucht Genmanipulation mehr als alle anderen, weil der Klimawandel Afrika viel härter trifft. Man nimmt nur die Gene einer Narzisse und gibt die in den Mais und dann ist der Mais Pest-resistent. Der einzige Grund, dass Europa Genmanipulation verbannt ist, dass die Agrarlobby eine Panikmache um gesundheitliche Folgen herbeigeschworen hat."
Paul Colliers Argumentation für den Einsatz von Gentechnologie in Afrikas Landwirtschaft ist unter Entwicklungsökonomen äußerst umstritten, denn meist werden gentechnisch veränderte Samen nur im Gesamtpaket mit Düngemittel verkauft und die Rechte zur Wiederverwendung der Pflanzen liegen bei den Verkäufern aus der Ersten Welt. Außerdem bliebe mit dem Einsatz von Gentechnik in Afrikas Landwirtschaft das Wissen in den Industrieländern. Diese Abhängigkeit ist nicht unbedingt erstrebenswert.
Hilfe von der Ersten Welt
Neben den ökonomischen Argumenten wird immer wieder der Einwand laut, dass man die Langzeitfolgen gentechnisch manipulierter Agrarprodukte und Lebensmittel noch nicht absehen könne. Ob mit Gentechnik oder ohne, die meiste Arbeit im Aufholen von Entwicklungsstufen, müsste Afrika selbst erledigen, aber wir - die Europäer -, schreibt Paul Collier, sollten ihnen beistehen.
Die Entwicklungsagenturen haben Schwierigkeiten, Mitarbeiter in den Tschad oder nach Laos zu beordern, die glanzvollen Posten sind Länder wie Brasilien und China. In jedem größeren Land mit einem mittleren Einkommen unterhält die Weltbank ein großes Büro, in der Zentralafrikanischen Republik hat sie keinen einzigen Vertreter.
Einleuchtende, aber umstrittene Erklärungen
Paul Colliers Erklärungen für die Entwicklungen der letzten 40 Jahre, in denen Afrika und Südostasien die unterste Milliarde - also das Schlusslicht der Dritten Welt - bilden, sind größtenteils einleuchtend. Neben Colliers These, dass die Gentechnologie gut für Afrikas Landwirtschaft sei, ist eine weitere unter Ökonomen höchst umstritten, nämlich die Behauptung, dass natürliche Ressourcen einen wirtschaftlichen Nachteil darstellen würden.
In jedem Fall ist "Die unterste Milliarde. Warum die ärmsten Länder scheitern und was man dagegen tun kann" auch für Nicht-Ökonomen leicht zu lesen und zu verstehen. Und es bleibt, trotz einiger umstrittener Thesen, ein Plädoyer dafür, die ärmste Milliarde Menschen auf dieser Welt nicht zu vergessen.
Hör-Tipp
Kontext, jeden Freitag, 9:05 Uhr
Buch-Tipp
Paul Collier, "Die unterste Milliarde. Warum die ärmsten Länder scheitern und was man dagegen tun kann", aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Rita Seuß und Martin Richter, C. H. Beck Verlag
Link
C. H. Beck - Die unterste Milliarde

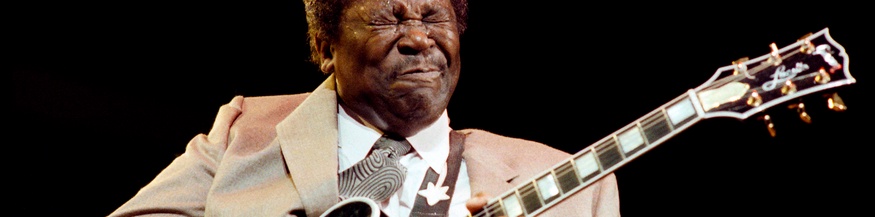

![[HTTPS://CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/BY-SA/2.0/DEED.DE|CC BY-SA 2.0] Ars Electronica Festival: Impressionen - Postcity](/i/related_content/be/0a/be0abe435ba816d5ee6c654aa7fcd6f770f4134e.jpg)
