Ein beweglicher Ort der Moderne
Die Geschichte des Fahrstuhls
In seinem Buch beschäftigt sich Andreas Bernard nicht nur mit dem Aufzug in Literatur und Film, ihm geht es in seiner originellen Studie auch um technische und städtebauliche, um soziologische und medizinische Aspekte des Fahrstuhls.
8. April 2017, 21:58
Mit dem Anwachsen der Städte wuchsen auch die Häuser: Waren bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts Häuser mit allenfalls ein oder zwei Obergeschoßen die Norm, so ermöglichten in den folgenden Jahrzehnten zeitgleich aufkommende Errungenschaften wie Zentralheizung, Kanalisation, Aufzüge und später auch Elektrizität deutlich höhere Gebäude.
Wolkenkratzer mit Stahlskelett
"Um 1875 bewirkt der Fahrstuhl in New York eine Aufstockung der Gebäudehöhe auf circa zehn Geschoße", berichtet Bernard. Die "elevator buildings" entstanden. Doch erst als in den 1880er Jahren der Stahlskelettbau entwickelt und wenig später der Hydraulikaufzug durch einen mit elektrischem Antrieb ersetzt wurde, wurden aus Hochhäusern Wolkenkratzer. Das 1913 fertig gestellte Woolworth-Gebäude hatte 55 Etagen, zu Fuß hätte man bis zur obersten Etage eine dreiviertel Stunde gebraucht, mit dem Fahrstuhl war das in wenigen Sekunden zu schaffen.
Der Siegeszug des Aufzugs war jedoch kein ungehinderter. "In den ersten Jahrzehnten gab es Probleme bei der Organisation des Gefährts, die uns jetzt exotisch und skurril erscheinen. Allen Ernstes hatte man am Anfang überlegt, den Fahrstuhl nach Fahrplan verkehren zu lassen, also zum Beispiel alle fünf Minuten. Dann gab es am Anfang in den Hotels nach Geschlecht getrennte Fahrstühle. Dann gab es die für uns heute sehr befremdliche Anweisung, dass Fahrstühle nur in den Geschäftsstunden funktionieren. Das sind sozusagen Probleme der Logistik", erzählt Bernard.
Eliminierung von Standesunterschieden
Der Fahrstuhl stellte die bestehende Ordnung auf den Kopf. War früher der erste Stock, die "Bel Etage", der beste und teuerste und die oberen Geschoße, die Dachzimmer, Domizil nur für Gesinde oder arme Poeten, so kehrt sich das nun in das Gegenteil: Die Spitzen der Gesellschaft thronen im Gipfel der Gebäude. Dabei bedeutete gerade für sie das Fahrstuhlfahren einen Verlust - an Machtentfaltung und Selbstinszenierung.
In der engen Kabine des Aufzugs kommen Statusunterschiede nicht zur Geltung. Kein Wunder, dass Monarchen vor dem Fahrstuhl "eine grundsätzliche Scheu" entwickelten, wie Bernard berichtet, der eine Koinzidenz erkennt zwischen dem Aufkommen des "Vertikaltransports" und dem "Ende der Monarchie". Er erwähnt Kaiser Franz Joseph I., der sich weigerte, seine Geliebte Katharina Schratt in ihrer hoch gelegenen Stadtwohnung zu besuchen - weil er "eine Aversion gegen Aufzüge" hatte.
Vertikale Breschen
Der Fahrstuhl ist mehr als ein Beförderungsmittel. Er ist, laut Bernard, ein "paradigmatischer Ort der Moderne". Er steht für Sachlichkeit, für Funktionalität, für Nivellierung. Der Fahrstuhl, glaubt Bernard, hat die Häuser geometrischer, die Städte kompakter, die Statusunterschiede unkenntlicher gemacht.
So wie die Stadtbaumeister der Moderne horizontale Breschen schlugen mit ihren Boulevards, Chausseen und U-Bahn-Tunnels mit dem Ziel, Ordnung und Transparenz zu schaffen und dem Wildwuchs des Gebauten mit dem "Prinzip der Geraden" zu begegnen, so schlagen Fahrstuhl und Aufzugsschacht eine vertikale Bresche durch die Ebenen der Häuser, die eine neue Übersichtlichkeit gewinnen.
Gründliche Recherche, originelle Aufbereitung
Andreas Bernards Buch stützt sich nicht nur auf wissenschaftliche und literarische Arbeiten, es zitiert auch Bauordnungen, Gebrauchsanweisungen, Reklameschriften, Lexikon- und Zeitungsartikel aus der Frühzeit der "sumptuous apartments" oder "ascending rooms", wie Fahrstühle auch genannt wurden. Es schildert Fahrstuhlunfälle, Fahrstuhlphobien und -legenden, wie jene von Elisha Otis, der weithin als Erfinder des elevator gilt, in Wahrheit aber nicht der erste war, der einen Personenaufzug baute, sondern nur der erste, der dessen gefahrloses Funktionieren theatralisch inszenierte.
Manches in dieser "Geschichte des Fahrstuhls" hätte knapper ausfallen, manches etwas weniger hochtrabend formuliert werden können - Bernard spricht von der "Semantik des Dachbodens", von der "Neucodierung der Vertikalen", von der "Theorie des Schachts". Anderes mag zunächst konstruiert klingen. Aber gerade das ist - neben der Gründlichkeit der Recherche - die überragende Qualität des Buches: Es schürft nicht nur im Verbürgten und Verlässlichen, es verbindet historische Darstellung mit theoretischer Reflexion und verblüfft mit gewagten Querverbindungen und überraschenden Verknüpfungen.
Hör-Tipp
Kontext, jeden Freitag, 9:05 Uhr
Buch-Tipp
Andreas Bernard, "Die Geschichte des Fahrstuhls. Über einen beweglichen Ort der Moderne", Fischer Taschenbuch Verlag, ISBN 978-3596173488

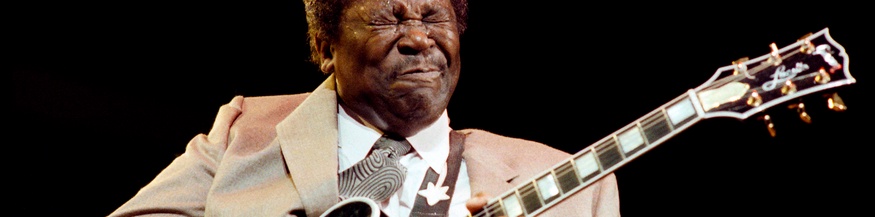

![[HTTPS://CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/BY-SA/2.0/DEED.DE|CC BY-SA 2.0] Ars Electronica Festival: Impressionen - Postcity](/i/related_content/be/0a/be0abe435ba816d5ee6c654aa7fcd6f770f4134e.jpg)
