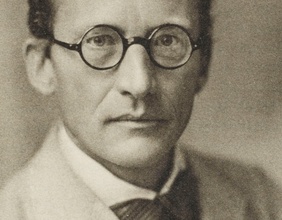Der Mai 1968 in Wien
Eine heiße Viertelstunde
1968 rebellierte eine neue, urbane Jugendkultur. In Deutschland brannten die Verlagshäuser des Springer-Konzerns, in Paris wurden Barrikaden errichtet. Und in Wien? Fritz Keller, ein Aktivist von damals, kann gerade mal eine heiße Viertelstunde erkennen.
8. April 2017, 21:58
1968 war immer schon ein bisschen mehr als die Summe der einzelnen Teile. Eine einheitliche Erzählung zum Zentraljahr der Studentenbewegung gibt es nicht: Auch in der Rückschau bestimmt der Standort den Standpunkt, wie unzählige Kommentare, Analysen und Bücher zum geschichtsträchtigen Jahr zeigen: Der "Mai 68" wird schnell zu "Mein 68".
Neuauflage nach 25 Jahren
Auch Fritz Keller hatte "sein" 68. Sein Text ist 1983 erstmals erschienen und Keller hat ihn seit damals nicht mehr wesentlich verändert. Damals wie heute verzichtet der Autor auf eine ausholende Metaanalyse der Geschehnisse, die sich aus der zeitlichen und emotionalen Distanz zu damals vielleicht aufdrängen würde.
Anstelle von pathetischen Beschwörungen eines Mythos 68 liefert Keller eine recht nüchterne, aber detailreiche Rückschau auf das Jahr 1968 in der Bundeshauptstadt. Keller war damals 18 Jahre alt und Mitglied des Verbands Sozialistischer Mittelschüler, einer Vorfeldorganisation der SPÖ, die im Jahr 1973 wegen andauernder Konflikte mit der Partei zerbrach.
Kreiskys Integrationsstrategien
Keller, der diesen Bruch aktiv mitbetrieben hat, fokussiert in seinem Buch stark auf die Kämpfe zwischen der SPÖ und ihren rebellierenden Jugendorganisationen. Er beschreibt, wie Bruno Kreisky auf die aufmüpfigen Jungsozialisten und -sozialistinnen mit Zuckerbrot und Peitsche reagierte.
Bruno Kreisky hat es verstanden, eine sehr entwickelte repressive Toleranz gegenüber den rebellischen Nachkommen anzuwenden", erzählt Fritz Keller. "Die bestand im Wesentlichen einmal darin, dass er sehr gerne erzählt hat, wie seine persönlichen Kontakte zu Fidel Castro und Che Guevara waren, es folgte dann die Einladung in die Armbrustergasse zum Butler, zu Wiener Schnitzel und Vogerlsalat, und dort wurde dann die Frage diskutiert, ob man nicht im Fordinstitut, oder in der Arbeiterkammer ein viel besseres berufliches Fortkommen haben könnte. Und auf die Art hat Bruno Kreisky eine ganze Generation von studentischen Rebellen mehr oder weniger integriert.
Deutsch-österreichische Differenz
Auch die Grabenkämpfe zwischen linken Splittergruppen ab Mitte der 1960er Jahre beschreibt Keller minutiös. Im Zentrum steht dabei die Wiener Universität, sie ist der Mittelpunkt des studentischen Protests.
Die Demonstrationen gegen den Wirtschaftsprofessor Taras Borodajkewycz im März 1965 waren Keller zufolge der Auftakt zu einer neuen Linken an der Universität. Borodajkewycz bekannte sich offen zu seiner nationalsozialistischen Vergangenheit und war damit der Star der rechten Studentenschaft. In seinen Vorlesungen an der damaligen Universität für Welthandel äußerte sich Borodajkewycz immer wieder antisemitisch.
Anders als in Deutschland habe es an den österreichischen Unis keine tiefgehende Entnazifizierung gegeben, schreibt Keller. Abgesehen von linken und kritischen Studenten fehlte ein Korrektiv innerhalb der Universität. Dies habe den Fall Borodajkewicz erst möglich gemacht. Die deutschen Unis hätten eine echte Re-Education durchgemacht, meint Keller,
da wurden die Nationalsozialisten auch wirklich entfernt. Und es wurde in das deutsche Bildungssystem etwas transplantiert, was so ein bisschen, würde man sagen, artfremd war, die Freie Universität Berlin. Und es kamen auch aus der Emigration die ganzen Exponenten der Frankfurter Schule, die eine ganz andere Denktradition und Denkrichtung für eine ganze Generation von Studenten etablierten. Alles Dinge, die in Österreich völlig undenkbar waren und auch unbekannt.
Eine Dokumentation, kein Lesebuch
Die Stärke des Buches ist vor allem sein Detailreichtum. Viele Seiten lang werden politische Flügelkämpfe und linke Richtungsdebatten geschildert, Akteure beim Namen genannt, Texte von Flugblättern und Demonstrationsaufrufe wiedergegeben. So ist das Buch vor allem eine zeitgeschichtliche Dokumentation, durch die man sich streckenweise allerdings regelrecht durcharbeiten muss. Ein Lesebuch im Sinne flüssiger Lektüre ist das 220 Seiten dicke Buch nicht.
Das Entstehen der Frauenbewegung
"Das Detail ist der Feind des Mythos" - so ließe sich Kellers Buch vielleicht überschreiben. Und man kann Keller zu Gute halten, dass er im aktualisierten Vorwort selbst darauf hinweist, dass sein Buch aus einer subjektiven und - wie er es nennt - "eingeschränkten" Sicht geschrieben ist.
Und weil 68 immer schon vor allem eine Geschichte der Männlichkeit war, sei der letzte Teil seiner Bestandsaufnahme lobend erwähnt: Hier widmet sich Keller nämlich dem Entstehen einer kritischen Frauenbewegung aus der linken Studentenschaft heraus. Schade, dass dieses Kapitel nicht einmal zehn Seiten lang ist. In den meisten von dabei gewesenen Männern geschriebenen Abhandlungen zu 68 fehlt es aber gänzlich - auch das sei erwähnt.
Mehr zu aktuellen Sachbuchrezensionen in oe1.ORF.at
Hör-Tipp
Kontext, jeden Freitag, 9:05 Uhr
Buch-Tipp
Fritz Keller, "Mai 68. Eine heiße Viertelstunde", Mandelbaum Verlag
Link
Mandelbaum Verlag - Mai 68