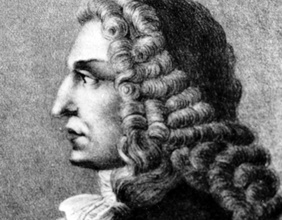Der Briefwechsel zweier Philosophen
Wie am selben Knochen
"Wir kamen damals zusammen, wie zwei Intellektuelle, die am selben Knochen nagen." Mit diesen Worten erinnerte sich Theodor W. Adorno im Rückblick an seine erste Begegnung mit Walter Benjamin. Aus ihren Gesprächen entwickelte sich ein reger Briefwechsel.
8. April 2017, 21:58
Während Theodor W. Adorno noch bis 1935 in Deutschland blieb, bevor er über England nach Amerika auswandern konnte, verließ Walter Benjamin seine Geburtsstadt Berlin bereits am 17. März 1933, sechs Wochen nach der nationalsozialistischen Machtergreifung. Nach gescheiterten Bemühungen um eine Habilitation Mitte der 1920er Jahre, war ihm im Gegensatz zu Adorno der Eintritt in eine vergleichsweise sichere Universitätslaufbahn verwehrt, jedoch hatte Benjamin sich als freier Schriftsteller profilieren können, indem er insbesondere die Methode der literarischen Kritik durch brillant formulierte, sorgfältig recherchierte Analysen perfektionierte.
Doch die Publikationsbedingungen hatten sich seit 1930 kontinuierlich verschlechtert, sodass die Emigration für Benjamin drei Jahre später unausweichlich wurde.
Am Rande des Existenzminimums
Im Pariser Exil setzte Benjamin trotz aller Widrigkeiten seine Arbeit fort. Zu französischen Intellektuellenkreisen kam trotz Benjamins zahlreicher vorangegangener Frankreich-Aufenthalte, seiner Übersetzungen von Baudelaire und Proust sowie seiner Rezensionen der französischen Literatur keine tragenden Verbindungen zu Stande.
In ebensolcher Distanz, wenn auch in diesem Fall selbst gewählt, lebte Benjamin zu den offiziellen Kreisen der exilierten deutschen Schriftsteller. Seine Lebensbedingungen bewegten sich am Rande des Existenzminimums. Ohne nennenswerte Einkünfte in Frankreich war Benjamin fast ausschließlich auf das Institut für Sozialforschung und die ihm vor allem von Adorno angebotenen Publikations- und Forschungsmöglichkeiten angewiesen.
Das Institut für Sozialforschung hatte 1933 rechtzeitig in die Schweiz übersiedeln und sein Vermögen transferieren können. Ab 1935 war es in den USA angesiedelt, wo neben Horkheimer und Pollock ab 1938 auch Adorno arbeitete. Auf Adornos Betreiben erhielt Benjamin monatlich eine feste Zuwendung, die seinen Lebensunterhalt sicherte, im Gegenzug stellte Benjamin seine Arbeitskraft dem Institut zur Verfügung.
Wichtiger Gedankenaustausch
Neben diesen ganz praktischen lebenssichernden Maßnahmen war für Benjamin vor allem der Briefwechsel mit seinem Freund Adorno eine wichtige Möglichkeit des Gedankenaustauschs und der Reflexion über die Arbeit. Der um einige Jahre jüngere Adorno, obwohl ein großer Bewunderer von Benjamin, erweist sich in seinen Briefen als unnachgiebiger Kritiker, wenn es um die großen theoretischen Aufgaben geht, die Adorno als gemeinsame ansah.
Ein zentrales Thema der Briefe sind die Fragment gebliebenen "Passagen" Benjamins, aber auch dessen Arbeit über Kafka sowie sein Baudelaire-Aufsatz für die Zeitschrift des Instituts für Sozialforschung werden ausführlich besprochen, manchmal eingehender, als Benjamin lieb sein konnte. Doch zählt der Briefwechsel zwischen Theodor W. Adorno und Walter Benjamin nicht zuletzt wegen seines philosophischen Gehalts zu den bedeutendsten, die aus dem vergangenen Jahrhundert überliefert sind.
Flucht nach Spanien
Mit Ausbruch des Zweiten Weltkriegs verschärfte sich die Situation für Benjamin in Frankreich. Als "feindlicher Ausländer" wurde er 1939 im Lager Clos St. Joseph in Nevers interniert, konnte durch Intervention einiger einflussreicher Freunde jedoch nach wenigen Monaten seine Entlassung erwirken.
Vor den anrückenden deutschen Truppen floh Benjamin über Lourdes nach Marseille, wo er auf Grund von Adornos Bemühungen ein Einreisevisum für die USA, sowie ein Transitvisum für Spanien und Portugal erhielt. Mit einer kleinen Gruppe, angeführt von Lisa Fittko, machte sich Benjamin zu Fuß auf den Weg über die Pyrenäen. In der Erinnerung von Lisa Fittko bestand der inzwischen herzkranke Benjamin darauf, während des über zehnstündigen anstrengenden Marsches auf einem Schmugglerpfad eine schwere Aktentasche mit sich zu schleppen, in der sich nach eigener Aussage sein neuestes Manuskript befand, welches unbedingt gerettet werden musste.
"Benjamin wanderte langsam und gleichmäßig. In regelmäßigen Abständen - ich glaube, es waren zehn Minuten - machte er Halt und ruhte sich für etwa eine Minute aus. Dann ging er in demselben gleichmäßigen Schritt weiter. Er hatte sich das, wie er mir erzählte, ausgerechnet: 'Mit dieser Methode werde ich es bis zum Ende schaffen. Die Pausen muss ich machen, bevor ich erschöpft bin. Man darf sich nie völlig verausgaben'."
Den Schlusspunkt setzen
Unter Lisa Fittkos Führung erreichte die kleine Flüchtlingsgruppe, zu der außer Benjamin noch Henny Gurland und deren Sohn gehörten, sicher die spanische Grenze, die sie auf Grund eines fehlenden Ausreisevisums aus Frankreich illegal zu übertreten gezwungen waren. Die spanischen Grenzsoldaten drohten, die Flüchtlinge zurück ins besetzte Frankreich zu schicken, gewährten ihnen aber auf Grund von Benjamins Gesundheitszustand eine Übernachtung im Grenzort Portbou. Dort nahm sich Benjamin in der Nacht vom 25. September 1940 mit einer Überdosis Morphium das Leben.
Während die ominöse Aktentasche mit dem Manuskript nie gefunden werden konnte, wurde Benjamins Abschiedsbrief an Adorno diesem später von Henny Gurland mündlich überliefert: "In einer ausweglosen Situation bleibt mir keine andere Wahl, als einen Schlusspunkt zu setzen. In einem kleinen Ort in den Pyrenäen, wo niemand mich kennt, werde ich mein Leben beenden. Bitte übermitteln Sie meinem Freund Adorno meine Gedanken und erklären ihm die Situation, in der ich mich befinde. Es bleibt mir nicht genug Zeit, um all die Briefe zu schreiben, die ich gern geschrieben hätte."
Mehr zu Theodor W. Adorno in oe1.ORF.at
Hör-Tipp
Hörbilder spezial, Freitag, 8. Dezember 2006, 10:05 Uhr
Download-Tipp
Ö1 Club-DownloadabonenntInnen können die Sendung nach der Ausstrahlung 30 Tage lang im Download-Bereich herunterladen.
Links
Philosophenlexikon - Theodor W. Adorno
Internationale Walter Benjamin Gesellschaft