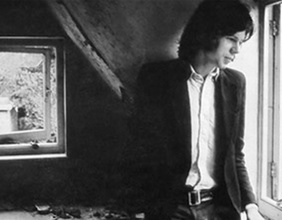Ein Stimmungsbericht vor den belgischen Wahlen
Bricht Belgien auseinander?
Vor den belgischen Kommunal- und Provinzwahlen am Sonntag, 8. Oktober, scheinen die Gemeinsamkeiten zwischen den Flamen und den Wallonen weitgehend aufgebraucht zu sein. Immer öfter ist von Trennung die Rede. Die Wahlen sind zum Stimmungstest geworden.
8. April 2017, 21:58
Pascal Delwit zum Streit der beiden Volksgruppen
In Belgien finden am Sonntag, 8. Oktober, Kommunal- und Provinzwahlen statt. Sie sind ein Stimmungstest für die Parteien, aber auch Stimmungstest für das Land, das immer mehr auseinander zu driften scheint. Denn nimmt man die politische Debatte in Belgien ernst, dann sind die Gemeinsamkeiten zwischen den Flamen und den Wallonen weitgehend aufgebraucht.
Die flämische Politik verlangt mehr Kompetenzen für die Regionen, soll heißen: mehr Eigenständigkeit für Flandern. Im Französisch sprachigen Landesteil argwöhnt man, dass dahinter der Wunsch nach völliger Unabhängigkeit Flanderns steckt.
Historische Hintergründe
Im Vorjahr feierte Belgien sein 175-jähriges Bestehen. Und verfolgt man die öffentliche Debatte, vor allem die Stellungnahmen flämischer Politiker, dann drängt sich der Eindruck auf, dass das Land seine 200-Jahrfeiern im Jahr 2030 womöglich gar nicht mehr erleben wird. Denn immer öfter fällt im Dauerkonflikt zwischen Flamen und Wallonen das Wort Trennung.
Der Konflikt der beiden Volksgruppen geht zurück bis zur Unabhängigkeit Belgiens von den Niederlanden. Was 1830 entstand, das war ein Staat, dessen Sprache Französisch war. Selbst die Oberschicht in Flandern sprach Französisch. Flämisch war damals die verachtete Sprache der Bauern. Die Flamen mussten lange um die Anerkennung ihrer Kultur und ihrer Sprache kämpfen. Erst hundert Jahre nach der Gründung Belgiens erhielten sie ihre erste Universität. Erst mit dem wirtschaftlichen Niedergang der bis dahin tonangebenden Wallonen in den 1950er Jahren kehrte sich das Verhältnis der beiden Volksgruppen nach und nach zugunsten der bis dahin unterdrückten Flamen.
Die heutige Situation
Die bitteren Erfahrungen der Vergangenheit scheinen nun in der Verbissenheit des Sprachenstreits der Gegenwart nachzuklingen. Dabei sei dieses Konfliktthema, so der Tenor in Belgien, ohnehin schon weitgehend entschärft. Flämisch ist neben Französisch und Deutsch eine der offiziellen Sprachen des Königreichs Belgien. Im Norden des Landes, in der Region Flandern wird Flämisch gesprochen, in der Wallonie Französisch. Die dritte Region Brüssel ist zweisprachig. Verbissen gestritten wird heute vor allem dort, wo die beiden Sprachgruppen zusammenleben müssen, wie in den flämischen Gemeinden rund um Brüssel. Dorthin ziehen immer mehr Französisch sprachige Bewohner der Hauptstadt.
Die Flamen sehen sich von der Zuwanderung in ihrem eigenen Territorium bedroht und bestehen rigoros darauf, dass sich ihre Landsleute anpassen und Flämisch sprechen. Das kann sogar dazu führen, dass eine Gemeinde den Kindern sogar verbietet, beim Spielen am Schulhof etwas anderes als Flämisch zu sprechen, wie kürzlich in der Gemeinde Merchtem bei Brüssel geschehen.
Kernproblem Finanzen
Trotz ständig präsenter Spannungen und Konflikte rund um Sprache und Kultur liegt das Kernproblem heute aber beim Geld. War einst die Wallonie vor allem wegen ihrer Stahlindustrie der reiche Teil Belgiens und Flandern der unterentwickelte, bäuerlich geprägte arme Teil, so haben sich diese Rollen nun komplett verkehrt: Flandern hat den Anschluss an moderne Schlüsselindustrien wie Bio- und Informationstechnologie geschafft. Die Wallonie kämpft noch immer mit den Folgen des Niedergangs der Schwerindustrie.
Über den föderalen Finanzausgleichs fließt viel Geld aus Flandern in den Süden - vor allem für die Sozialversicherung. Dabei wird in Flandern das Gefühl verbreitet, man werde von den Wallonern ausgebeutet. Die regelmäßigen Korruptionsskandale im Umkreis der dominanten wallonischen Sozialisten verstärken diesen Unmut. Der flämische Ruf nach Kompetenzverlagerungen wird immer lauter. Wenn es nach den flämischen Politikern geht, soll die Sozialversicherung in die Kompetenz der Regionen wandern - eine für die Frankophonen inakzeptable Forderung. Diesbezügliche Verhandlungen im kommenden Jahr dürften daher zusätzlich Zündstoff in das explosive Verhältnis der beiden Sprachgruppen bringen.
Nicht nur sprachliche Barrieren
Verstärkt werden die Probleme natürlich auch dadurch, dass in Belgien zwei Gesellschaften nebeneinander her leben, ohne viel voneinander zu wissen: mit getrennten Öffentlichkeiten und getrennter Politik. Es gibt keinen nationalen Wahlkreis und keine nationalen Parteien. Mit Ausnahme von Brüssel können Flamen nur Flamen und Frankphone nur Französisch sprachige Politiker wählen.
Dennoch halten viele Intellektuelle eine Trennung beider Volksgruppen für wenig wahrscheinlich. Der Politologe Pascal Delwit etwa fragt, was dann mit Brüssel geschehen soll, auf das keine der beiden Sprachgemeinschaften verzichten will: "Außerdem gibt es Druck von seiten der EU, die keinen weiteren Präzedenzfall für separatistische Tendenzen vom Baskenland bis Schottland duldet. Das ganze Problem wird vom Ausland viel dramatischer dargestellt, als es für einen geeichten Belgier ist." Ähnlich sieht dies der Sozialwissenschafter Marc Swyngedouw von der Universität Leuven, für den letztendlich die Haltung der Bevölkerung zum Thema Spaltung entscheidend ist.
Politiker und Unternehmer sprechen von Trennung
Jene, die eine Spaltung dennoch nicht ausschließen wollen, weisen darauf hin, dass in jüngster Zeit auch flämische Wirtschaftstreibende öffentlich über die Vorteile einer Trennung nachdenken. Ganz zu schweigen von flämischen Politikern, die immer offener von Trennung sprechen oder Belgien in Frage stellen.
So bezeichnete der christdemokratische Ministerpräsident der Region Flandern, Yves Leterme in einem Interview mit der französischen Tageszeitung Liberation Belgien als historischen Zufall, viel jünger als die Sprachgrenze. Die Kluft zwischen Flamen und Frankophonen würde immer größer. Gemeinsam - so Leterme - hätte man nur noch den König, das Fußballteam und manche Biere. Die Entrüstung der frankophonen Politik und Öffentlichkeit war ihm damit sicher. Bloß ein weiterer Akt in einer nicht ganz ernst zu nehmenden Posse? Selbst jene, die an den Fortbestand Belgiens glauben, sind sich da nicht mehr so ganz sicher.
Download-Tipp
Ö1 Club-DownloadabonnentInnen können die Sendung "Europa-Journal", vom Freitag, 6. Oktober 2006, 18:20 Uhr zum Thema "Bricht Belgien auseinander?" nach der Ausstrahlung 30 Tage lang im Download-Bereich herunterladen.
Links
Consulat général de Belgique à Montréal - Belgische Wahlen
Wikipedia - Belgien