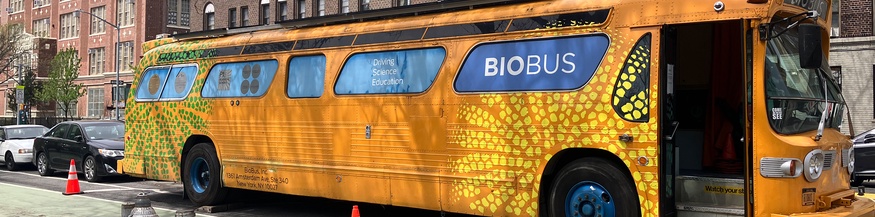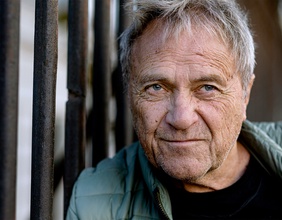Harmlose Schnäppchen oder Beihilfe zum Terror?
Plagiate, Fälschungen, Raubkopien
Der Kauf einer gefälschten Rolex ist keine Schnäppchenjagd mehr, sondern wird streng bestraft. Produktpiraterie ist ein weltweites Geschäft und wichtiger Teil der organisierten Kriminalität geworden. Selbst Terrororganisationen finanzieren sich durch gefälschte Waren.
8. April 2017, 21:58
Gesprächs-Exkurs über die Folgen der Produktpiraterie
Die gefälschte Rolex von einem Strandhändler kaufen? Vielleicht auch eine gefälschte Louis-Vuitton-Tasche? Auf den ersten Blick ein harmloses Vergnügen, vielleicht auch ein Stück Verachtung für die Luxusbranche, die den Menschen vorgaukelt, sie seien durch den Kauf solch sündteurer Artikel schon was Besseres.
Schön, dass es pfiffige Burschen gibt, die der Luxusindustrie die lange Nase zeigen, mag man sich denken. Aber Vorsicht vor solchen voreiligen und falschen Gedankenschlüssen! Denn Produktpiraterie ist illegal und kann nicht nur zu empfindlichen Geldstrafen, sondern auch zu Freiheitsentzug führen.
360 Milliarden Umsatz weltweit
Das Fälschen bzw. Nachahmen von Produkten und Marken macht heute weltweit schon 360 Milliarden Euro Umsatz. Fünf bis sieben Prozent des Welthandels findet mit gefälschten Waren statt. Damit ist Produktpiraterie eine der am schnellsten wachsenden Branchen der Welt.
Das Handeln mit gefälschten Waren verletzt aber gewerbsmäßig und kriminell Schutzrechte. Nach und nach ist es immer mehr zu einem wichtigen Teil der organisierten Kriminalität geworden und wird daher künftig streng bestraft werden. Dennoch wird weiter gefälscht, was das Zeug hält. Die Palette reicht von Software, Uhren, Bekleidung, Medikamenten, Autoteilen bis hin zu kompletten Kraftfahrzeugen. Einer der Schwerpunkte bei der Herstellung gefälschter Produkte ist China.
Fälschen ist wie Mozart nachspielen
"Es ist nicht nur kriminelle Energie, die den tüchtigen Chinesen zum tüchtigen Fälscher macht", betont Maximilian Burger-Scheidlin, Experte für Produktpiraterie in der Internationalen Handelskammer. Kopieren entspreche in China einer kulturellen und einer moralischen Werthaltung:
"Ein Chinese fertigt eine Kopie mit dem gleichen Bewusstsein an, mit dem ein westlicher Musiker Mozart spielt", sagt der Wirtschaftsmanager. "Das Motiv ist dabei Verehrung für den Meister - das Bestreben, so gut zu werden wie er." Das zeige auch die chinesische Kunstgeschichte, in der das, was wir im Westen als Epigonentum abqualifizieren, als große Tugend angesehen wird. Geistiges Eigentum - so der Experte - ist in China nicht Eigentum einer Person, sondern Eigentum des Reiches der Mitte, das ja nach seinem Selbstverständnis Mittelpunkt der Welt ist.
Chinesisches Eigenleben trotz strenger Gesetze
Die illegale Reproduktion und Imitation von Produkten hat sich in China zu einer Form der Parallel-Industrie entwickelt und umfasst praktisch alle Bereiche. Gleichwohl bemüht sich das offizielle China heute darum, geistiges Eigentum besser zu schützen, sagt Burger-Reichlin.
Die Gesetzeslage sei gar nicht so schlecht, meint der Wirtschaftsexperte: "Dass Produktpiraterie eine verbotene Sache ist, ist in China durchaus bekannt. Aber erstens hängt es davon ab, wie gut ein westliches Unternehmen sein Patent juristisch abgesichert hat, und zweitens führt so manche Provinz ein Eigenleben. Dabei geht es weniger darum, die Gesetze aus Peking zu vollziehen, sondern um die Arbeitsplätze in der eigenen Region zu sichern. Das muss gar nicht mit Korruption zusammenhängen, die ein eigenes Kapitel darstellt."
Illegale Fertigungsstätten
Maximilian Burger-Scheidlin nennt auch Beispiele aus eigener Anschauung: "Eine illegale Zigarettenfabrik in einem aufgelassenen Bergwerksstollen, zugänglich nur durch ein manngroßes Loch. Durch dieses Loch werden auch die zerlegten Maschinen in die Stollen gebracht und dort zusammengebaut. Oder: Illegale Fabriken sind von vornherein in Containern untergebracht, und wenn die Behörden dahinter kommen, werden die Container mitsamt Menschen und Maschinen einfach in die Nachbarprovinz befördert."
Nach den Worten des Wirtschaftsmanagers werden diese illegalen Fertigungsstätten ganz unterschiedlich betrieben: Familien, die abends im Hof ein paar Sachen zusammenkleben, gebe es ebenso wie mafiaähnliche Gebilde mit richtigen Großbetrieben. Dennoch werden - so Burger-Scheidlin - pro Monat 30 bis 40 illegale Fabriken geschlossen.
Beihilfe zum Terror
Aber nicht nur in China würden illegal Waren erzeugt, betont Burger-Scheidlin. Die Produktpiraterie sei ein Phänomen der internationalen organisierten Kriminalität: "Auch Drogenbarone, denen das Geschäft zu heiß geworden ist, steigen auf Produktpiraterie um, ebenso Terrororganisationen finanzieren sich so." Der Manager nennt in diesem Zusammenhang die nordirische IRA, die Al-Kaida in ihrem Anfangsstadium, aber auch tschetschenische Terroristen in Russland oder die Hisbollah.
Der Kampf gegen Produktpiraterie ist also nicht nur Handlangertum für die Luxusindustrie, die um ihre Gewinne fürchtet. Einen Fortschritt sieht der Wirtschaftsexperte darin, dass die G-8, also die Gruppe der wichtigsten Industrieländer inklusive Russland, das Thema geistiges Eigentum in ihre Schlussdokumente aufgenommen hat. Und auch Indien und China würden sich - so Burger-Scheidlin - des Problems immer mehr bewusst, je mehr sie eigene Forschungsergebnisse schützen wollen.
Neue EU-Richtlinie in Vorbereitung
Auch EU-Justizkommissar Franco Frattini unterstreicht, dass das Nachahmen und Fälschen von Produkten nicht nur für Einzeltäter zum lukrativen Geschäft, sondern auch immer mehr zu einem Delikt des organisierten Verbrechens wird. Zudem gehe das Herstellen illegaler Kopien oft mit der Ausbeutung von Kindern einher. Die Produktpiraterie schrecke auch nicht mehr vor Medikamenten sowie Nahrungsmitteln zurück.
Daher will die EU-Kommission den Mitgliedsländern mit einem Vorschlag für die Bekämpfung von Produktpiraterie erstmals Vorschriften für das nationale Strafrecht machen. Der Richtlinienvorschlag sieht dabei eine Mindest-Geldstrafe von EUR 100.000,- vor. Sie kann EUR 300.000,- betragen, wenn es sich um ein Verbrechen im Rahmen einer kriminellen Vereinigung handelt oder Menschen gefährdet wurden. Auch eine Freiheitsstrafe von mindestens vier Jahren soll künftig in schweren Fällen möglich sein.
Mehr dazu in Ö1 Inforadio
Hör-Tipp
Saldo, Freitag, 8. September 2006, 9:45 Uhr
Download-Tipp
Ö1 Club-DownloadabonnentInnen können die Sendung nach der Ausstrahlung 30 Tage lang im Download-Bereich herunterladen.
Links
Wikipedia - Produktpiraterie
International Chamber of Commerce - BASCAP
Finanzministerium - Produktpiraterie
Konsumenteninformation - Produktpiraterie
Arbeiterkammer - Gefälschte Waren
EU-Kommission - Bilateral Trade Relations
Internationale Handelskammer Österreich