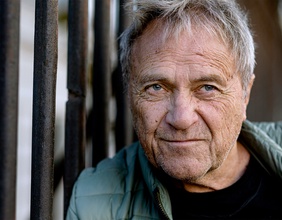Authentizität durch Unnachahmbarkeit
Die Diva - am Beispiel Maria Callas
Leonhard Bernstein nannte sie sogar die größte Künstlerin der Welt: Maria Callas, die Primadonna assoluta. Aber es war nicht nur der einzigartige Glanz ihrer Stimme und die Wandlungsfähigkeit ihres Temperaments, die den Ruhm der Sängerin ausmachten.
8. April 2017, 21:58
Primadonna assoluta, La Divina, Queen of Opera - von Maria Callas wird stets nur in Superlativen gesprochen. Kaum eine Sängerin vor oder nach ihr hat das Bild von der Grandesse und Grazie der Operndiva so nachhaltig geprägt wie sie. Leonhard Bernstein nannte sie sogar die größte Künstlerin der Welt. Ein Talent, das man nicht einfach nur zur Blüte bringen, sondern dem man sich ergeben, dem man dienen muss.
Aber es war nicht nur der einzigartige Glanz ihrer Stimme und die Wandlungsfähigkeit ihres Temperaments, die den Ruhm der Callas ausmachten. Es waren nicht zuletzt auch die Eleganz ihrer Posen, die Strenge und Disziplin ihres Einsatzes und die unendliche Hingabe zu ihrer Kunst, bis zur Selbstaufopferung, die sie bis heute zur Legende machen. Damit war eine hohe Latte für alle gelegt, die nach ihr kommen sollten.
Authentizität und Unnachahmbarkeit
Aber selbst diejenigen, denen es gelingt, in die Nähe der Callas gerückt zu werden, wissen nur allzu gut, dass das noch lange nicht bedeutet, gleichrangig mit ihr zu sein. Der Hauch von Unnahbarkeit und Unerreichbarkeit gehört nicht zuletzt auch zum Wesen der Diva, in der Oper genauso wie im Film-, Musik- und Showgeschäft. Was sie aber dennoch über den Glanz des regulären Stars hinauswachsen lässt, ist die Tatsache, dass in ihrem Leben die Grenze zwischen Öffentlichkeit und Privatheit stets verschwimmt.
Private Schicksalsschläge durchkreuzen und inspirieren stets die perfekte Inszenierung, weshalb für die Diva die Tragödie auch kein Ende nimmt. Doch aus dieser Verletzlichkeit auf der Bühne wie im Leben, aus der offen zur Schau getragenen Schwäche bezieht die künstliche Erscheinung der Diva auch ihre Authentizität und Unnachahmbarkeit.
Zwei Wesen - Maria und Callas
Im Interview erklärte Maria Callas einmal: "Es gibt zwei Wesen in mir: Maria und Callas. Ich stelle mir gerne vor, dass sie zusammengehören, denn in meiner Arbeit ist Maria immer anwesend. Der Unterschied ist nur, dass Callas eine Berühmtheit ist."
Im Spannungsfeld zwischen Substanz und Erscheinung
Diese Zerrissenheit, die das Wesen der Diva kennzeichnet, ähnelt nicht zufällig dem Konzept des königlichen Doppelkörpers, der noch bis ins 19. Jahrhundert prägend für das Bild von Prominenz und Berühmtheit war. So wie Fürstinnen und Regentinnen stets in zwei Körpern wohnten - im symbolischen Körper der Herrscherin und dem physischen Körper einer schönen Frau, so lebt auch die moderne Diva immer im Spannungsfeld zwischen Substanz und Erscheinung. Zwischen der Zerbrechlichkeit ihres privaten Egos und der Perfektion ihres öffentlich inszenierten Bildes.
Keine wusste mit dieser Ambivalenz derart gekonnt zu spielen, wie die Callas. Aber auch kaum eine andere wurde von den Konflikten, die sich daraus ergaben, so zerrieben wie sie. Persönliche Auseinandersetzungen und Prozesse mit Operndirektoren sowie private Rivalitäten zogen sich wie ein roter Faden durch ihre Karriere. Gespickt mit spektakulären Absagen, plötzlich abgebrochenen Vorstellungen und Abwesenheit bei Pressekonferenzen und anderen Terminen in der Öffentlichkeit.
Intensität durch permanenten Widerspruch
Die Vehemenz, mit der sie einen Restbestand an Selbstbestimmung im streng reglementierten Opernbetrieb zu verteidigen suchte, brachte ihr nicht nur Bewunderung, sondern auch den Vorwurf ein, eine maßlose Egozentrikerin und launische Hysterikerin zu sein. Blickt man aus heutiger Sicht auf den nach wie vor ungebrochenen Mythos der Callas zurück, wird klar, dass beide Seiten, die Strenge und Perfektion der Bühnenfigur genauso wie die Unberechenbarkeit und Wankelmütigkeit der privaten Maria im Wesen der Diva untrennbar zusammengehören.
Denn ihr einzigartiges Talent, Menschen zu berühren, die Intensität, mit der sie vorgegebene Rollen verkörpert, entsteht ja genau aus dieser Zerrissenheit zwischen Extremen, aus einem Leben in permanentem Widerspruch. "Die Callas hat Rollen nicht nur gespielt, sondern wie auf der Rasierklinge gelebt", schrieb Ingeborg Bachmann in einer Hommage an die wohl größte Operndiva aller Zeiten. "Sie ist das letzte Märchen, die letzte Wirklichkeit, deren Zuhörer hoffen konnten teilhabend zu werden".
Verfall der Diva als Star-Gattung
Bachmanns Absolutheit gilt hier nicht nur der Einzigartigkeit der Callas. Ihr Verweis auf die letzte Wirklichkeit nimmt auch einen schleichenden Verfall der Diva, als spezifischer Star-Gattung, vorweg. Denn die mediale Durchdringung der Welt, in der "celebrity" allgegenwärtig und Berühmtheit inflationär geworden ist, hat auch den Glanz der Diva verblassen lassen. Zwar werden talentierte Sängerinnen nach wie vor gerne als solche bezeichnet. Doch der Kult rund um ihre Erscheinung reicht bei weitem nicht an die Ehrfurcht und Ergebenheit heran, wie sie noch vor 50 Jahren gang und gäbe war.
Darin mag man ein gesundes Maß an Ernüchterung oder gar eine Demokratisierung im Kampf um Aufmerksamkeit erkennen. Doch fest steht damit auch, dass eine spezifische Form von Identifikationsfigur und glanzvoller Ausnahmeerscheinung abhanden gekommen ist. Zurückbringen wird man sie so schnell nicht können. Sich aber an ihr spezifisches Wesen und ihre Eigenart zu erinnern, ist zur Abwechslung vielleicht ganz wohltuend. Mit Sicherheit aber amüsant.
Hör-Tipp
Radiokolleg, Montag, 14. August, Mittwoch, 16. August und Donnerstag, 17. August 2006, jeweils 9:45 Uhr
Veranstaltungs-Tipp
Ausstellung "Maria Callas. Die Kunst der Selbstinszenierung", Donnerstag, 1. Juni bis Sonntag, 17. September 2006, Theatermuseum,
Ö1 Club-Mitglieder erhalten ermäßigten Eintritt (33 Prozent).
Links
Literaturhaus Wien - Ingeborg Bachmann
Maria Callas
Österreichisches Theatermuseum