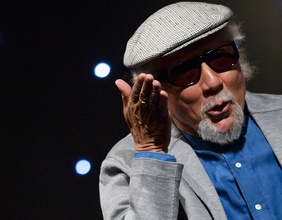An der Grenze von Vergangenheit und Zukunft
Volksgruppen in Kärnten
Es gibt keine politische Einigung im Kärntner Ortstafelstreit. Martin Hitz, einer der Herausgeber des Buches "Grenzfall Kärnten", tritt dafür ein, die sprachliche und kulturelle Vielfalt Kärntens zu fördern. Auf Ö1 stellte er sich Hörerfragen.
8. April 2017, 21:58
Hörerfragen an Martin Hitz
Martin Hitz, Universitätsprofessor für Informatik, hat gemeinsam mit dem Historiker Karl Stuhlpfarrer ein Buch über die Mehrsprachigkeit und das Zusammenleben der Volksgruppen in Kärnten herausgegeben.
Angesichts der neuen Auseinandersetzungen um eine Lösung der Frage zweisprachiger Ortstafeln in Kärnten war er bei Rainer Rosenberg in der Ö1 Sendung "Von Tag zu Tag" zu Gast. Der mehrfach mit Zweisprachigkeit vertraute Universitätsprofessor beantwortete auch Hörerfragen über den "Grenzfall Kärnten".
"Die Grenze, die zelebriert wird, ist eine künstliche"
Rainer Rosenberg: Was für Grenzen sehen sie bei diesem Grenzfall?
Martin Hitz: Ich sehe die wesentlichste Grenze darin, dass in Europa alle Völker zusammenwachsen sollen und wir uns hier jenseits dieser philosophischen Grenze befinden, wo seit 50 Jahren und speziell seit dem Ortstafelsturm 1972 die Grenze quasi zelebriert wird. Das ist aus meiner Sicht grenzwertig, nicht mehr zeitgemäß.
Diese Grenze geht ja nicht quer durchs Dorf, sondern verläuft zwischen den Menschen und muss sehr oft, könnte man als Nicht-Kärntner glauben, erst konstruiert werden.
Selbstverständlich sind diese Grenzen konstruiert, denn die Definition, wer zu welcher Volksgruppe gehört, lässt sich wissenschaftlich überhaupt nicht geben. Tatsache ist, dass die Kultur Kärntens seit vielen hundert Jahren dadurch konstituiert ist, dass es zwei Sprachgruppen gibt, und dass die slowenische Sprachgruppe seit dem Beginn des letzten Jahrhunderts drastisch dezimiert wird. Und dass aber auch innerhalb dieser Sprachgruppe unklar ist, ob sich jemand dem Slowenischen eher hingezogen fühlt oder dem Deutschen. Das sind lauter Dinge, die total verschwimmende Grenzen habe. Die Grenze, die zelebriert wird, ist eine künstliche, eine konstruierte.
In Europe werden 200 verschiedene Sprachen gesprochen, es muss also überall solche Grenzflächen geben. Das ergibt meines Erachtens eine große Chance. Denn wir sind ja alle Opfer oder Objekt der Globalisierung, in deren Zuge wir Gefahr laufen, dass unsere Kulturen glatt- und weg geschliffen werden zugunsten eines einheitlichen Phänotyps des westlichen Konsummenschen. Um dem einen gewissen Widerstand entgegen zu bringen, sollten wir doch gerade diese Buntheit, die einzelne Gegenden in Europa - insbesondere hier im Zentrum Mitteleuropas - aufweisen, herausstreichen und pflegen, anstatt uns mit politischen Kleingeldwäschereien das Leben schwer zu machen.
Ist die zweisprachige Ortstafel für Sie das Symbol nach außen: Hier finden unterschiedliche Kulturen gemeinsam statt?
Das ist sicherlich ein Symbol für mich, offensichtlich auch für die slowenische Volksgruppe ein ganz wichtiges Symbol. Ich seh' das natürlich bunter. Da gibt's nicht nur die Ortstafeln. Da gibt's andere topografische Aufschriften, der Staatsvertrag spricht ja nicht von Ortstafeln, sondern von topografischen Aufschriften insgesamt. Auf der anderen Seite sieht man, dass man in Kärnten im slowenischen Bereich lauter deutsch klingende Namen findet, genauso wie das halbe Klagenfurter Telefonbuch mit slowenischen Namen gefüllt ist. Da sieht man auf allen möglichen Ebenen diese Jahrhunderte lange Koexistenz der Sprachen und die Kohabitation der Bevölkerung.
Hat die vielzitierte "Kärntner Urangst" heute noch eine Existenzberechtigung?
Ich befinde mich von meiner Biografie her in einer Situation, wo ich glaube, dass ich beide Teile durchaus verstehe, glaube aber, dass der deutsche Teil dieses Konflikts eine Argumentation benützt, die obsolet ist. Die berühmte "Kärntner Urangst", die ich bis zu einem gewissen Grad gut verstanden habe, hat heutzutage wirklich keine Grundlage mehr - 86 Jahre nach der Kärntner Volksabstimmung, 50 Jahre nach dem Staatsvertrag (in dem ja auch Jugoslawien mit unterschrieben hat, dass Territorialforderungen der Vergangenheit angehören), 15 Jahre nach dem Zerfall Jugoslawiens und zwei Jahre nach dem EU-Beitritt Sloweniens.
Das hat ja auch Josef Feldner, der Vorsitzende des Heimatdienstes, ziemlich deutlich gesagt. Da hat sich ja in der Haltung des Heimatdienstes viel geändert.
Ja, ich war ganz erstaunt und erfreut, dass auch auf Seiten des Heimatdienstes ein Umdenken stattgefunden hat. Das Problem scheint aber zu sein, dass ein gewisser Teil der Bevölkerung nicht wirklich aufgeklärt wird und sich diesem Diskurs nicht stellt und andererseits leider die Politik diversester Couleurs versucht, mit entsprechenden Stellungnahmen Wählerstimmen einzuheimsen. Dadurch wird diese meiner Ansicht nach unsinnige Grenze perpetuiert.
Mehr dazu in Ö1 Inforadio
Download-Tipp
Ö1 Club-DownloadabonnentInnen können die Sendung "Von Tag zu Tag" vom Freitag, 14. Juli 2006, 14:05 Uhr nach der Ausstrahlung 30 Tage lang im Download-Bereich herunterladen.
Buch-Tipp
"Grenzfall Kärnten", Martin Hitz und Karl Stuhlpfarrer (Hrsg.), Wieser Verlag, ISBN 103851296397
Mehr dazu in oesterreich.ORF.at
Link
Wieser Verlag