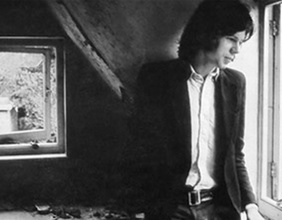Wo liegen die Gründe der Differenzen?
Der Islam und die westliche Welt
Eine bedrohliche, eher rückständige islamische Welt versus kolonialistischer und global herrschsüchtiger Westen: diese Stereotypen, Vorurteile und Feindbilder sind auf beiden Seiten tief verankert. Wo liegen die Wurzeln der bestehenden Vorurteile?
8. April 2017, 21:58
Viele verschiedene Staaten mit ihren jeweils eigenen Geschichten, Kulturen, Traditionen, Sprachen werden mangels differenzierteren Verständnisses als "die islamische Welt" zusammengefasst. Das diffuse Gefühl davon, was damit gemeint ist, führt zwangsläufig zu einer Reihe von Vorurteilen, die vor allem auf zwei Pfeilern ruhen, meint der Iranwissenschaftler Bert Fragner, geschäftsführender Direktor des Instituts für Iranistik der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.
Zum einen auf Analogieschlüssen, die aber nur in den seltensten Fällen der Realität standhalten, zum anderen auf dem Verständnis der Idee der Aufklärung. Insbesondere der Islam wurde von europäischen Denkern immer wieder als Kontrastprogramm zur Aufklärung interpretiert.
Unüberbrückbare Differenzen?
Wenn es darum geht, wie "die islamische Welt" "den Westen" sieht, stellt sich nicht nur die Frage, was "die islamische Welt" eigentlich ist, sondern umgekehrt natürlich auch, was mit "der Westen" gemeint ist.
Die Politik des Westens in Form der aktuellen Politik der USA wird zwar gerne zum Gegenpol oder Feindbild stilisiert - die Kluft ist aber keineswegs unüberbrückbar. Was die Lebensart betrifft, hat genau dieser Westen eine große Anziehungskraft auf vor allem auf viele Jugendliche, beobachtet die Islamwissenschaftlerin Katajun Amirpur.
Religiöse Gefühle oder Politik?
In der öffentlichen Wahrnehmung wirkt es jedoch meist so, als würden die Gegensätze diesen gemeinsamen Nenner bei weitem überwiegen. Vermeintlich unüberwindbare Differenzen in der Auffassung zu für westliche Demokratien so wesentlichen Bereichen wie Meinungs- und Pressefreiheit zum Beispiel schien der Karikaturenstreit Anfang des Jahres exemplarisch offenbart zu haben.
Für Katajun Amirpur hatten die heftigen aber späten Reaktionen in vielen islamisch geprägten Ländern allerdings wenig mit Religion oder der angeblichen Verletzung religiöser Gefühle und einem Protest gegen die Meinungsfreiheit zu tun - sondern sie dienten gesteuerten politischen Zwecken.
Ein kollektives Gefühl der Demütigung
Der Islamwissenschaftler und Leiter des Deutschen Orient-Instituts Udo Steinbach ist überzeugt davon, dass es vor allem ein Unterlegenheitsgefühl ist, dass die Erklärung für viele Formen radikaler und extremistischer Positionen liefert.
Ein diffuses Unterlegenheitsgefühl alleine reicht aber noch nicht, um aus einer Religion ein Politikum zu machen. Dafür bedarf es Vordenker und politischer Führer, die ein Programm entwickeln und es in die Tat umzusetzen versuchen. Udo Steinbach versucht, Schlüsselfiguren dieses Prozesses in der islamischen Welt auszumachen, wie zum Beispiel Sayyid Qutb.
Der 1906 geborene Sayyid Qutb gilt als wichtiger Theoretiker der im Nahen Osten einflussreichen Muslimbruderschaft und war ein Vordenker des weltweiten Kampfes für die Einführung der Scharia, der religiösen Pflichtenlehre des Islam. Als Regimekritiker wurde er unter Staatspräsident Gamal Abdel Nasser verhaftet und 1966 zum Tod verurteilt.
Das Tempo der Veränderungen nimmt zu
Was das Konfliktpotential zwischen dem Westen und der islamischen Welt betrifft, so hat das Tempo der Veränderungen in den letzten Jahren nach Udo Steinbachs Einschätzung sprunghaft zugenommen. In den Entwicklungen der jüngeren Vergangenheit - im Irak, im Nahen Osten, im Iran - ortet der Islamwissenschaftler eine Eskalation der Entfremdung.
Vielleicht habe Samuel Huntington mit seinem viel zitierten und viel diskutierten "Clash of Civilisations" ("Kampf der Kulturen") vielleicht doch gar nicht so unrecht, meint Udo Steinbach.
Der US-amerikanische Politikwissenschaftler und Autor Huntington hat in seinem 1996 erschienenen Buch die These diskutiert, dass die Nationalstaaten im 21. Jahrhundert als zentrale politische Akteure ausgedient haben könnten, und dass neue Konflikte zwischen aber auch innerhalb von Nationalstaaten zunehmend kulturell geprägt sein würden.
Hör-Tipp
Salzburger Nachtstudio, Mittwoch, 27. September 2006, 21:01 Uhr
Download-Tipp
Ö1 Club-DownloadabonnentInnen können die Sendung nach der Ausstrahlung 30 Tage lang im Download-Bereich herunterladen.
Buch-Tipps
Samuel Huntington, "Kampf der Kulturen", aus dem amerikanischen Englisch von Holger Fließbach, btb Verlag, ISBN 3442755069
Henryk M. Broder, "Hurra, wir kapitulieren", Wjs Verlag, ISBN 393798920X
Mehr dazu in oe1.ORF.at