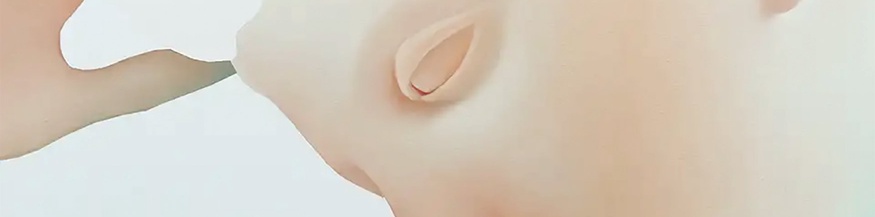Die Deutschen und Benedikt XVI.
"Wir sind Papst"
Mit ihrem Titel "Wir sind Papst" hat die "Bild"-Zeitung am 20. April 2005 Mediengeschichte geschrieben. Ein Jahr danach nahm dies die SPD-nahe "Friedrich-Ebert-Stiftung" in Berlin zum Anlass, sich mit dem Verhältnis der Deutschen zum Papsttum auseinanderzusetzen.
8. April 2017, 21:58
Matthias Drobinski war vor und bei der Papstwahl dabei
Der gebürtige Bayer Joseph Ratzinger lebt seit einem Vierteljahrhundert in Rom und wurde in der "Ewigen Stadt" anstandslos als neuer Oberhirte akzeptiert. In Deutschland hatte er allerdings bis zu seiner Wahl zum Papst ein ausgesprochen negatives Image. Der Konflikt um die Schwangerenkonflikt-Beratung hat gezeigt, dass sich auch die deutschen Bischofskollegen nicht leicht mit ihm taten.
Die Wahl Ratzingers zum Papst löste dennoch großen Jubel in unserem Nachbarland aus, obwohl sie auch indirekt Auswirkungen auf das Verhältnis der beiden großen Kirchen Deutschlans zueinander hat. Die evangelische Kirche fühlt sich nämlich durch die massenmediale Präsenz der Katholiken zunehmend an den Rand gedrängt.
Der achte deutsche Papst
Joseph Ratzinger - nunmehr: Benedikt XVI. - ist nach allgemeiner Auffassung der achte Deutsche auf dem Papstthron. Wobei deren letzter, Hadrian der Sechste, aus Utrecht stammte und damit - nach heutigem Maßstab - Niederländer war. Hadrian starb 1523 und war damit auch der letzte Nicht-Italiener auf dem Papstthron, bis 1978 Karol Woityla zum Nachfolger Petri gewählt wurde. Der erste deutsche Papst hingegen - Gregor der Fünfte - regierte von 996 bis 999 - und wurde vor seiner Wahl Bruno von Kärnten genannt, obwohl in der Steiermark geboren. Ein Österreicher, also?
Wie dem auch sei: Joseph Ratzinger ist ein echter Deutscher. 1927 in Marktl am Inn geboren, in Traunstein aufgewachsen und später Professor in Regensburg wurde er Erzbischof von München und schließlich als Präfekt der römischen Glaubenskongregation die rechte Hand von Johannes Paul II. Trotz seiner fortgeschrittenen Jahre galt er als logischer Nachfolger. Dennoch kam seine Wahl am 19. April 2005 überraschend.
Die Aufregung in Deutschland war gewaltig: Das Haus des greisen Ratzinger-Bruders Georg in Regensburg wurde von Kamerateams belagert. Die Medien schienen tagelang kein anderes Thema mehr zu kennen. Und die "Bild"-Zeitung hat mit ihrer Schlagzeile "Wir sind Papst" Mediengeschichte geschrieben.
Der Aufstand Roms gegen die Moderne
Ein Jahr danach lud die Friedrich-Ebert-Stiftung - die Parteiakademie der SPD - zu einem hochkarätig besetzten Symposion mit dem Titel "Papsttum und Politik" nach Berlin, um dem neu gewonnenen Interesse am Papsttum auch wissenschaftlich gerecht zu werden. Unter den Referenten auch ein Augenzeuge der Ereignisse in Rom im April 2005: Matthias Drobinski, Redakteur der "Süddeutschen Zeitung" mit dem Fachgebiet Kirche und Religion.
Zentrales Thema der Diskussion war der "Aufstand Roms gegen die Moderne". Dobrinski meinte u. a., in der Auseinandersetzung der Kirche mit einer säkularisierten Gesellschaft habe Joseph Ratzinger als Präfekt der Glaubenskongregation eine klar definierte Rolle gespielt. Seine Predigt 'wider den Relativismus' und seine ersten Worte als Papst 36 Stunden danach ließen aber einen schlagartigen Wandel des Menschen Joseph Ratzinger feststellen, der auch ein knappes Jahr später in seiner ersten Enzyklika "Deus caritas est" klar zum Ausdruck gekommen sei.
"Gott ist die Liebe ...
"... und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott, und Gott bleibt in ihm. Mit diesen Worten beginnt die erste Enzyklika von Papst Benedikt XVI. - für viele ein viel versprechender Wegweiser seines künftigen Pontifikats, trifft sie doch den Wesenskern des Christentums.
Als jenes erste Lehrdokument am 25. Jänner dieses Jahres von Papst Benedikt XVI. veröffentlicht wurde, war die Überraschung noch größer, denn niemand hatte erwartet, dass sich der ehemalige langjährige Präfekt der Glaubenskongregation, den Kritiker vielfach als "Hardliner" bezeichneten, bei seiner Antritts-Enzyklika dem Thema "Caritas" - "Liebe" widmen wird.
Ein Wechsel der Perspektive bedeutet aber nicht unbedingt eine Veränderung des Standpunktes, betonte Matthias Drobinski beim Symposion in Berlin. Auch der Historiker Wolfgang Reinhard bestätigte: "Gerade Papst und Kirche haben sehr viel zur Entwicklung des modernen Staates beigetragen". Die Entwicklung einer säkularen Gesellschaft sei ja bereits im jüdisch-christlichen Gottesbild angelegt.
Historische Gegebenheiten
Historisch betrachtet wurde der Papst selbst zum politischen Faktor: mit einem eigenen Staat und zeitweise mit beträchtlicher militärischer Macht. Mit dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation stand das Papsttum immer in einem spannungsreichen Verhältnis. Der Höhepunkt war der Investiturstreit - der Streit zwischen geistlicher und weltlicher Macht um die Einsetzung kirchlicher Amtsträger. Der Gang Heinrichs des Vierten nach Canossa ist bis heute sprichwörtlich. Letztlich sei aber die Existenz des Kirchenstaates der wichtigste Schlüssel zum politischen Verständnis des Papstums - bis tief ins 19. Jahrhundert hinein, so die Historikerin Birgit Emich:
"Als im Jahr 1870 der Kirchenstaat endgültig zugrunde ging, zogen sich die Päpste als 'Gefangene'" in den Vatikan zurück, bis mit den Lateranverträgen 1929 der gegenwärtige Zustand - der Zwergstaat 'Vatikanstadt' - geschaffen wurde. Inhaltlich verschaffte das Ende des Kirchenstaates den Päpsten eine neue Bewegungsfreiheit gegenüber dem Staat" informierte Emich weiter: "Die Forderung nach einem katholischen Glaubensstaat - als Idealvorstellung - war damit aber noch nicht vom Tisch. Erst das Zweite Vatikanische Konzil konnte sich zur Mitte des 20. Jahrhunderts zu einer echten Neutralität gegenüber der Staatsform durchringen - eng verbunden mit dem Durchbruch zur Anerkennung der Religionsfreiheit".
Der" italienisierte" Papst
Die Diskussion bei der Tagung der sozialdemokratischen Friedrich-Ebert-Stiftung in Berlin führte auch mitten in das komplexe historische Verhältnis zwischen dem Papst in Rom und dem deutschen Kaiser, zwischen der römischen Kurie und dem Heiligen Römischen Reich - also letztlich auch: zwischen der deutschen und der italienischen Nation:
"Italien ist immer schon ein 'Sehnsuchtsland' der Deutschen gewesen - spätestens seit den Reisen eines Johann Wolfgang von Goethe", betonte der Historiker Volker Reinhardt. Umgekehrt hätten auch die Italiener von alters her ein besonders Verhältnis zu den "Barbaren" nördlich der Alten gepflegt. Wenn schon nicht als eine von Gott "erwählte Nation" - so hätten sich die Italiener doch immerhin als die "religionsbringende Nation" empfunden. "Dennoch" - so Reinhardt - "stand der Wahl eines Deutschen zum Papst grundsätzlich nichts im Wege". Seine Begründung:
"Italienischer Kulturvorrang zeigt sich ja gerade darin, dass er aufnahmebereit für stimulierende Anstöße von außen ist, wobei diese durch den Prozess der Vereinnahmung zugleich 'italienisiert' und veredelt werden. Auch Personen werden 'italienisiert'. Mit anderen Worten: Wenn Joseph Ratzinger als geborener Deutscher Papst wurde, dann wohl deshalb, weil ihn die Kurie inzwischen italienisiert und entsprechend entbarbarisiert betrachtet".
Benedikt XVI. in Warschau
Der nach Meinung von Volker Reinhardt "italienisierte" Papst Benedikt XVI. selbst absolviert derzeit seine erste heikle Auslandsreise. Nach der triumphalen Rückkehr in die deutsche Heimat zum Weltjugendtag in Köln im August des Vorjahres besucht er dieser Tage Polen, die Heimat seines populären Vorgängers. Gerade in Polen steht Benedikt XVI. noch ganz im Schatten von Johannes Paul II. - dem großen Sohn der polnischen Nation.
Die Visite in Polen wird von politischen Beobachtern aber auch deswegen als schwierig angesehen, weil sie Benedikt XVI. mit den dunkelsten Kapiteln der deutschen Geschichte konfrontiert: Mehr als sechs Millionen Polen wurden im Zweiten Weltkrieg getötet. Von den dreineinhalb Millionen polnischen Juden überlebten nur wenige Zehntausend den Holocaust. Deshalb wird der deutsche Papst zum Abschluss seiner viertägigen Reise am Sonntag, 28. Mai, auch das ehemalige deutsche Vernichtungslager Auschwitz besuchen.
Mehr zu Papst Benedikts Besuch in Warschau in Ö1 Inforadio
Hör-Tipp
Logos, Samstag, 27. Mai 2006, 19:05 Uhr
Download-Tipp
Ö1 Club-DownloadabonenntInnen können die Sendung nach der Ausstrahlung 30 Tage lang im Download-Bereich herunterladen.
Link
Papst Benedikt XVI.